Ideengeschichte des Zusammenhangs von Kannibalismus und Aufklärung
Einen Menschen mit dessen ausdrücklicher Zustimmung töten und essen: Als Armin Meiwes Tat vor gut fünfzehn Jahren bekannt wurde, regte sie – neben dem obligaten ungläubigen Entsetzen – bald schon gesellschaftliche, rechtliche und letztlich philosophische Fragen an, die trotz eines rechtskräftigen Urteils 2007 als unbeantwortet, womöglich sogar als unbeantwortbar gelten können. Auch wenn der kannibalische Akt anfänglich als Totschlag, dann aber als Mord qualifiziert wurde, hat seine störende Wirkung Bestand – nicht als individuelles Ereignis alleine, sondern als Paradigma: Er bleibt Ausdruck für eine in unserer Zeit virulente Verunsicherung gesellschaftlicher Normen, die unschwer als Erbe von Humanismus und Aufklärung erkennbar sind.
Zwei Grundprinzipien der aufgeklärten Vernunft kollidieren: die Freiheit des rationalen (Aus-)Handelns einerseits und die Pflicht gegenüber einem impliziten Gesellschaftsvertrag, der Allgemeinheit keinen Schaden zuzufügen, andererseits. Im Idealfall ergänzen sich beide Prinzipien: Der Vernunftgebrauch fördert die Gemeinschaft und vice versa, denn was allen nützt, nützt auch dem einzelnen. Eine kannibalische Beziehung, wie die vorliegende, spottet diesem Humanismus und stellt in Frage, was ‚vernünftig’ und was ‚nützlich’ ist. Der (im Laufe des Prozesses zurecht angezweifelte) freie Wille zweier mündiger Bürger, die sich in einem gemeinsamen Vertrag über die Verfügung ihrer Körper einigen, die sich also nicht nur ihres Verstandes, sondern auch ihrer Leben auf freie und mutige Weise zu bedienen wagen, scheint unvereinbar mit der Idee einer Gesellschaft, deren Fortentwicklung und Verbesserung diese Individuen sichern sollen. Es ist, als ob Meiwes die doppelte Bedeutung von ‚Sapere aude!’ in einer zynischen Finte beim Wort genommen hätte: Sapere heisst nicht nur Wissen, sondern auch Kosten und Schmecken.
Gegen diese böswillige Buchstäblichkeit seiner Definition von Aufklärung kann man mit Kant einwenden, dass ein kannibalischer Vertrag der aufgeklärten Moral gerade spottet, denn hier scheint ein Mensch nur Mittel, nicht Zweck zu sein. Die Mittel-Zweck Relation selbst aber wird verunsichert durch den Genuss, der sich für den jeweiligen Vertragspartner aus dem Genuss seines Gegenübers ergibt: Erst das Wissen darum, ihm seinen größten Wunsch zu erfüllen, ja sein Leben (wenn auch durch Zerstörung) vollständig zu machen, habe den Vertrag als beidseitiges Genussversprechen ermöglicht. Erneut könnte man mit und gänzlich gegen die Intention von Kant argumentieren: Die persönliche Befindlichkeit, sei sie erregt oder angewidert, darf bei dieser Erfüllung der höchsten Pflicht, den anderen gänzlich als Zweck und darum als Mittel zu sehen, keine Rolle spielen.

Weitere Online-Anzeige von Armin Meiwes unter dem Pseudonym „Franky“ nach der Tötung seines Opfers. Diese Anzeige hat vermutlich zur Verhaftung Meiwes‘ geführt. Teile des Forums Cannibal Cafe, auf dem „Franky“ inseriert hat, sind noch heute archiviert.
Diese einleitende philosophische Provokation[1] will nicht darüber hinwegtäuschen, dass der reale Fall des ‚Kannibalen von Rotenburg’ eine Tragödie war, in der Einsamkeit und Abhängigkeit zentrale Rollen spielten. Die aufgerufenen kantischen Modelle können diese psychologischen Abgründe nicht erhellen. Als das verletzte Selbstwertgefühl des Opfers und die menschenverachtende Obsession des Täters gänzlich zutage traten, bröckelte die Fassade einer freien und mündigen Übereinkunft. Meiwes Verteidigung aber pochte bis zuletzt auf die Einvernehmlichkeit des kannibalischen Kontrakts und plädierte auf Tötung auf Verlangen. Mit Recht wurde diese Sicht abgelehnt. Zuvor jedoch verunsicherte die aufgeklärte Rhetorik der Anwälte nicht nur die erste richterliche Instanz – deren Urteil auf Totschlag ihnen weit entgegenkam –, sondern auch die Öffentlichkeit. Die Argumentation der Verteidiger hätte eine Jury von der Legitimität der Tat wohl überzeugen können, wäre alles so geschehen, wie Meiwes es beschrieb und wie er wohl tatsächlich glaubte, dass es geschehen ist.
Auch wenn es eine solche Tat nach bestehendem Wissen nie gegeben hat, wird sie doch durch die Vorkommnisse in Rotenburg vorstellbar. Folgt man der Herausforderung einer aufgeklärten Rechtfertigung von Kannibalismus, muss sich der Blick deshalb auf das Gebiet der Fiktion richten – und das heißt in jenes Gebiet, in dem Kannibalismus tatsächlich eine Vielzahl von Apologien wiederfuhr. Um solche fiktionale Apologien geht es im Folgenden. Dass ihre Einführung gleichsam durch einen Umweg über den realen Fall erfolgte, soll nicht bloß die soziale und philosophische Relevanz dieser Fiktionen untermauern, sondern ihre problematische Trennung von Fiktion und Fakt von Anfang an in den Vordergrund rücken: In Apologien des Kannibalen rührt Imaginiertes an Wirklichem; wie Armin Meiwes ist auch der fiktionale Kannibale eine Figur, die gesellschaftliche Normen in Frage stellt.
Die moralische Verunsicherung geht mit einer ästhetischen einher: Zur Rechtfertigung des Kannibalen werden meistens Bilder genutzt, die emotional oder affektiv überwältigen, die also sehr real wirken und in Form von Schweißausbrüchen oder Erbrechen ganz körperliche Wirkungen zeigen können. Solche ästhetischen Grenzüberschreitungen werden immer wieder als gefährlich eingestuft; wer an ihnen Gefallen oder Genuss findet, so lautet eine weitverbreitete Vorstellung, mag sie eines Tages in die Realität umsetzen. Und tatsächlich scheint der Fall Meiwes dafür gute Gründe zu geben: Er besaß eine Vielzahl einschlägiger Kannibalen-Filme und setzte sein Vorhaben erst nach Rollenspielen um, für die er Spielgefährten im Internet suchte und fand. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch klar, dass Meiwes’ Obsession, die bereits in seiner Kindheit erwachte, ihn vielmehr zum Konsum dieser Medien bzw. zu Umwegen über die Fiktion motivierte, als dass sie alleine für seinen ungewöhnlichen Appetit verantwortlich gewesen wären. Er selbst behauptete in einem Interview, ausgerechnet die beschauliche Verfilmung von Robinson Crusoe von 1954 hätte ihn auf den Gedanken gebracht, Menschen zu essen. Kein blutiges Vergnügen also, sondern der – rein physiologisch gesehen nicht irrationale – Gedanke, dass mit dem Verspeisen seines toten Stammesmitgliedes dieser Teil des eigenen Körpers werde, sei der Initiationspunkt des zukünftigen Kannibalen gewesen. Wie dem auch gewesen sein mag: Meiwes ohne drastische Kannibalen-Filme ist denkbar – aber können wir die Provokation von Meiwes aufgeklärter Rechtfertigung verstehen ohne fiktionale Erzeugnisse, die seine Tat als medial vermitteltes Ereignis vorwegnehmen?
Die Frage des ästhetischen Genusses derartiger Darstellungen sollte nicht im Lichte prohibitiver Volkserziehung, sondern als Herausforderung für ein schonungsloses Denken betrachtet werden. Dietmar Dath hat in diesem Sinne die ästhetische Praxis der Drastik, also des schockierend deutlichen Zeigens von „Blut, Sperma, Pisse“[2] und anderer Körperlichkeiten, als Phänomen der Aufklärung beschrieben. Die drastische Präzision im Herstellen kausaler, aber fiktionaler Zusammenhänge jenseits von humanistischen Erwägungen erzeuge eine „formalisierte Vernunft als Ästhetik innerhalb einer inhaltlich unvernünftigen Gesellschaft“[3]: Diese Gesellschaft habe ihren Humanismus längst verraten, ekle sich aber, wenn ihr der Verrat in Form vermeintlich inhumaner Kunst vor Augen geführt werde.
Dath sieht in der Drastik, die er ausschließlich in subkulturellen Erzeugnissen verortet, eine implizite Gesellschaftskritik. In den kannibalisch-apologetischen Spezialfällen von Drastik, die längst auch in der Kulturindustrie auftauchen, findet dagegen eine explizite Kritik statt. Diese Kritik unterscheidet sich von der Kritik, die Dath anspricht: Drastik ist hier nicht eine Schwundstufe der Aufklärung, die instrumentelle Vernunft beinahe inhalts- und kontextlos in Szene setzt, sondern eine sonderbare Potenzierung aufklärerischer Ideale. Im selben Maße, in dem der vorliegende Versuch auf Daths Konzept drastischer Kunst aufbaut, muss dieses Konzept auch revidiert und erweitert werden. Reklamieren Dath und seine Gewährsmänner wie Walter Benjamin oder Siegfried Kracauer das politische Potenzial vermeintlich unaufgeklärter künstlerischer Erzeugnisse, indem sie diese für ein Programm der Aufklärung retten wollen, so wird hier umgekehrt – und darum ergebnisoffener – zuerst nach der Aufklärung durch diese Kunst gefragt.
Wie Meiwes entwerfen fiktionale Kannibalen vernünftige Kontrakte. Sie richten sich dabei nicht zwingend wie der Kannibale von Rotenburg an ihre Opfer oder zumindest nicht allein an ihre Opfer. Ihre Kontrakte sind universeller Natur: Mit einem zynischen Gesellschaftsvertrag richten sie sich an die gesamte Gesellschaft; mit einem ästhetischen Kontrakt, was Genuss sein kann, wenden sich an ihre Leser oder Zuschauer; mit einem Neuentwurf gemeinsamer körperlicher Erkenntnis adressieren sie das moderne Vernunftsubjekt per se. Diesen Kontrakten ist gemein, dass sie neu ordnen, was Teilhabe an der Welt in ihrem basalsten, von aller Metaphysik bereinigten – und damit womöglich aufgeklärtesten – Sinne bedeutet: Körper zu haben und sie zu teilen.
Die Geburt der vernünftigen Kannibalen
In den Künsten war Anthropophagie schon immer ein verbreiteteres Phänomen als in der faktualen Welt. Kannibalismus alleine ist darum, wie der Fall Meiwes’ zum Erstaunen vieler zeigte, kein Strafbestand und wird nur illegal durch die Störung der Totenruhe. Trotzdem haben sich bislang nicht primär die Literatur-, Kunst- und Filmwissenschaft mit dem Thema beschäftigt, sondern die Anthropologie. Dort hat man sich nach jahrzehntelangen, zuweilen hitzigen Debatten darauf geeinigt, dass zwar überall auf der Welt Kannibalismus zu finden war und ist, als soziale Praxis aber die Ausnahme bildet. Eine anthropologische Konstante hingegen ist der Mythos des Kannibalen,[4] der in Form des schuldbeladenen Gründervaters (der griechische Urvater Saturn) oder des Schreckgespenstes (der mittelalterliche Kinderfresser, der Wendigo amerikanischer Indigener) in kaum einer Kultur fehlt.
Unbeantwortet blieb bislang die Frage, was es heisst, Kannibalismus zu rechtfertigen. Während Hungerkannibalismus in Extremsituationen bereits seine eigene Entschuldigung im Namen trägt, scheinen alle anderen Formen von Kannibalismus wenig Überlegungen zu ihrer Legitimität provoziert zu haben. Es ist ein Allgemeinplatz, dass der Menschenfresser noch das letzte Tabu der westlichen Gesellschaft überschreitet und seine Figur deshalb das ultimativ ‚Andere’, das Gefürchtete, aber auch ex negativo das Identitätsstiftende dieser modernen Gesellschaft darstellt. Allgemeinplätze lassen freilich abgelegenere Zu- und Ausgänge übersehen, die wiederum zu anderen Orten führen, die es erst noch zu verstehen gilt. In unserem Fall sind diese anderen Orte Räume, in denen der Kannibale nicht länger eine Figur der Alterität, sondern eine Figur kritischer Selbstbehauptung, also ein ausdrückliches Selbst ist – und damit das genaue Gegenteil des klassischen Menschenfressers, wie ihn Odysseus in der Gestalt Polyphems antrifft. Der Ithaker, so beobachten Adorno und Horkheimer, „nennt sich Niemand, weil Polyphem kein Selbst ist, und die Verwirrung von Name und Sache verwehrt es dem betrogenen Barbaren, der Schlinge sich zu entziehen“.[5]
Der Kannibale, von dem hier die Rede ist, ist nicht die Negativfolie der Aufklärung, vor der sich der moderne Held ab- und auszeichnet, sondern, wie Dath für seine drastische Darstellung festgestellt hat, ein Kind derselben. Die Schlinge des vernünftigen Kannibalen ist ebenso effizient wie diejenige Odysseus’. Der aufgeklärte Menschenfresser mag ein illegitimes Erzeugnis, ein Bastard sein, legt aber dennoch ein kritisches Zeugnis darüber ab, was Aufklärung auch ist. Eine Dialektik der Aufklärung im Sinne Adornos kann er aber nicht bezeugen: Die drei kritischen Kontrakte, die in diesem Essay anhand seiner Figurationen nachgezeichnet werden, haben nicht die Aufklärung zum Gegenstand, sondern sind – und dies ist ihre eigentliche Problematik – aufklärerisch: Kannibalismus zu rechtfertigen, heißt Licht in ein Dunkel bringen, das gemeinhin als Undurchdringlich gilt.
Über kannibalische Ästhetik lässt sich nicht ohne eine Ethik des Zynismus oder Vitalismus, über diese nicht ohne eine Epistemologie der profanierten Körperlichkeit sprechen. Kritisch sind die Rechtfertigungen des Kannibalen also gleich doppelt im kantischen Wortgebrauch: Sie sind selbstkritisch im Sinne einer Selbstbeurteilung und Selbstbehauptung (und nicht etwa einer Bemängelung), und sie sind transzendental, weil sie nach den Bedingungen von Ästhetik, Moral und Erkenntnis fragen.
Eine kritische Funktion ohne diesen explizit transzendentalen Anspruch nahm der Kannibale schon vor Kant im philosophischen Diskurs ein. 1580, keine hundert Jahre nach der ‚Entdeckung’ Amerikas und der Ableitung des Begriffs ‚Kannibale’ aus dem Namen der Kariben, entwirft Montaigne in seinem Essay Des Cannibales eine erste Apologie der vermeintlich anthropophagen Indigenen. Sie seien Repräsentanten des Naturrechts: im rituellen Verspeisen des besiegten Kriegsgegners zeige sich die urtümliche Leidenschaft des unverdorbenen Menschen, der wie die Natur weder unnötiges Leiden noch Verschwendung zulasse. Eine eigene, kritische Stimme haben diese immerhin menschlichen Geschöpfe noch nicht – ebensowenig wie später bei Voltaire, Forster oder Herder, die alle im Rahmen ihrer anthropologischen Projekte Verständnis für den Kannibalen aufbringen. Letzterer schreibt ihm gar eine „grobe politische Vernunft“ zu:[6] Auch der ‚Wilde’ folgt Herders „Gesetz der Billigkeit“, das anstelle eines universalen Naturrechts einen Pluralismus kultureller Moralkonzepte vorsieht. Aber erst um 1800, in der Sattelzeit unserer Moderne, als die alten philosophisch-naturrechtlichen Diskussionen über den Kannibalen zu verstummen anfangen,[7] beginnt der Menschenfresser in der ebenfalls autonom werdenden Kunst von und für sich selbst zu sprechen.
Diese Selbstermächtigung der Fiktion ab 1800 folgt zwei Grundtendenzen: Einerseits erzeugt sie eine Anthropophagie aus Leidenschaft, in welcher der kannibalische Körper zum vernünftigen Subjekt wird. Andererseits betritt ein Kannibalismus aus Berechnung die Bühne der Kunst, der den gastronomischen Genuss anstrebt. Findet im ersten Fall eine Ermächtigung des Körpers gegen die Triebkontrolle statt, so schwingt sich im zweiten Fall das intellektuelle Subjekt zum absoluten Souverän über den eigenen und die fremden Körper auf. Die beiden Richtungen unterscheiden sich in ihrer Darstellungsweise. Der leidenschaftliche kannibalische Körper ist ein tragisches Sujet, dessen Tragik komische Momente nicht ausschließt. Der berechnend-geniessende kannibalische Intellekt trägt zynische Züge. Diese Züge verdankt er zwar seinen satirischen Vorläufern, deren Doppelbödigkeit aber lässt er zugunsten eines grotesken Ernstes hinter sich zurück. Wenn Jonathan Swift in seinem Modest Proposal (1729) vorschlug, die armen Iren sollen ihre Nachkommen verspeisen, ist der Unernst dieses Gedankens noch offensichtlich, für die Kannibalen Marquis de Sades, Georg Taboris oder Bret Easton Ellis gilt dies, wie wir sehen werden, nicht mehr.
Die beiden Tendenzen kannibalischer Selbstbehauptung – der tragische Körper und der zynische Intellekt – korrespondieren zudem mit den zwei vorherrschenden naturwissenschaftlichen Körperbildern ihrer Zeit, dem mechanistischen und dem vitalistischen Erklärungsansatz des Lebens. Ist für ersteren der Körper vom ihn beherrschenden Geist getrennt, so erscheint im zweiten der Körper selbst als Funktion einer beide umfassenden Lebenskraft. Diese Aufwertung des menschlichen Körpers überlebt den Vitalismus als biologisches Theoriegebäude im engeren Sinne in Form verschiedener Episteme, die sich etwa auf Nietzsche und die Lebensphilosophie berufen können. Es sei darum im Folgenden erlaubt, in Ermangelung eines besseren Begriffs auch noch von vitalistischen Kannibalen im 20. Jahrhundert zu sprechen. Spätestens mit Armin Meiwes und seinen popkulturellen Doppelgängern wie Hannibal Lecter vereinen sich jedoch zynische und vitalistische Tendenzen zum Bild eines leidenschaftlichen und zugleich kontrollierten Menschen, der die Trennung von Körper- und Geistesvernunft unzulänglich erscheinen zulässt.
In den literarischen Anfangspunkten der beiden Tendenzen um 1800 zeichnet sich je eine Rechtfertigungsstrategie in Grundzügen ab, die sich jedoch noch nicht völlig entfaltet, denn in beiden Fällen unterminieren die Apologien sich letztlich selbst. Auf diese Weise prätypisch ist erstens Kleists Penthesilea (1808), die bekanntlich Achilles, Gegner und Geliebter zugleich, in einem Anflug von vermeintlichem Wahnsinn zerfleischt. Als Amazonin noch halb Natur- und Stammesmensch, halb schon modernes Mangelwesen, rationalisiert sie später ihren Triebverlust, indem sie ihn durch den wohl berühmtesten ‚Versprecher’ der Literaturgeschichte motiviert: „So war es ein Versehen. Küsse, Bisse,[/] Das reimt sich und wer recht von Herzen liebt,[/] Kann schon das eine für das andere greifen.“[8] Dass die Klimax des tragischen Heroismus Penthesileas zugleich komische Züge trägt, lässt sich auf Voltaires Lexikoneintrag zum Kannibalismus zurückverfolgen, der humoristisch auf die unmögliche Nähe von Küssen und Essen aufmerksam macht, damit aber auch die Basis für ihre Vergleichbarkeit legt.[9]
Der Humor, der so oft mit der Unkontrollierbarkeit von Körperfunktionen einhergeht, ist hier gleichsam Einfallstor für eine eigene körperliche Logik. Denn unvernünftig scheint Penthesilea ihre Verwechslung nicht. Ja eigentlich handle es sich gar nicht um einen Versprecher, sei der Kannibalismus doch bereits in jeder Liebesbeziehung angelegt, in der man sich „vor Liebe gleich“ ‚essen’ wolle. Nur im Gegensatz zur „Närrin“, die die Redewendung gedankenlos ausspreche, habe Sie, Penthesilea, es „wahrhaftig Wort für Wort getan; ich war nicht so verrückt als ich wohl schien.“[10] Die Vernunftkritik, die in dieser Behauptung angelegt ist, wertet das Rationale nicht ab, sondern öffnet es gegenüber einer neuen Sprach- und Körperlogik, in der auch dem Eigensinn des Unbewussten und des Körperlichen Vernunft zugesprochen wird (man beachte hierzu auch Kleists Essay Über das Marionettentheater, 1810). An den Moment der Tat kann sie sich rückblickend nicht mehr erinnern, erst die Erzählung ihrer Dienerin bringt sie zu Bewusstsein und lässt sie rational nachvollziehen.
Penthesileas Mord am wehrlosen Achill ist bei aller Tragik eine Lösung des inneren Widerspruchs, an dem die Amazonin litt. Die starken Gefühle von gekränktem Stolz und unbändigem Hass einerseits und rasender Liebe andererseits brechen sich in einer Tat Bahn, in der beiden Genüge getan wird. Hierin zeichnet sich die erbarmungslose Modernität von Kleists Drama ab. Es orientiert sich zwar in Motivik und Drastik an Euripides Bakchen, die Schuldfrage wird jedoch nicht wie dort durch eine äußere, metaphysische Macht suspendiert. Ist es in den Bakchen Dionysos, der die Königsmutter Agaue zum Zerfleischen ihres Sohns Pentheus anstiftet, so nimmt bei Kleist das Unbewusste und die Eigenlogik des Körpers dessen Funktion ein. Wie Agaue ist Penthesilea ohne Schuld aufgrund einer Macht, die stärker als ihr Subjekt ist – und doch ist Penthesilea auch diese Vitalkraft jenseits von Gut und Böse. Der dialektische Eigensinn ihres Körpers ermöglicht Penthesilea letztlich einen Selbstmord ohne Hand an sich zu legen. In der letzten Szene arbeiten bewusster Wille und verselbständigter Körper derart zusammen, dass alleine ihr „vernichtendes Gefühl“ den Tod bewirkt.[11]

Pentheus wird von den Bacchantinnnen zerrissen. Attische Amphora um 480 v. Chr., Kimbell Art Museum, Fort Wort.
Die zweite Tendenz kannibalischer Selbstermächtigung, die um 1800 ihren Ausgang nimmt, behauptet keine neue Körpervernunft. Vielmehr baut sie auf eine kartesianische, mechanistische Körperlichkeit, also das Gegenteil von Penthesileas leidenschaftlicher Leiblichkeit. Marquis de Sades Monstrum Minski in Juliette, ou les Prospérités du Vice (1797) ist deshalb aber kein Kannibale der kühlen Vernunft. Das Gegenteil ist der Fall: Während Descartes den Körper als Maschine beschrieb, um damit umso klarer seine Unterwerfung unter die menschliche Ratio hervorzuheben, interessiert sich dieser Kannibale für den körperlichen Mechanismus im Dienste des Genusses. Vernunft und Genuss fallen zusammen, weil selbstsüchtiger Genuss ihm das einzig Vernünftige erscheint. Der menschliche Körper ist eine Genuss-Maschine im zweifachen Sinn eines Produzenten und Konsumenten von Genüssen. Infolgedessen, so argumentiert der Kannibale, bedarf es einer neuen Moral, die seinem Körper- und Vernunftbild Rechnung trägt.
Minski ist wie Penthesilea ein Mischwesen: Halb märchenhafter „ogre“, halb hochgebildeter Aristokrat ist sein Platz innerhalb und außerhalb der Gesellschaft. In seiner Physiognomie äußert sich dies geradezu karikaturistisch, denn einerseits verfügt er über einen gezwirbelten Schnurrbart, andererseits über ein „ebenso braungebranntes wie schreckenerregendes Gesicht“.[12] Die Amibivalenz setzt sich in seinem Wohnsitz fort, Minskis Burg befindet sich zwar inmitten einer unzugänglichen italienischen Gebirgslandschaft, ist jedoch über ein Netz von Dienern mit ganz Europa verbunden. So wird er beständig mit jungen Frauen und Männern versorgt, die ihm als Sex-Sklaven und Nahrung dienen. Jeder Geschlechtsakt ist eine Hinrichtung, jede Hinrichtung eine Schlachtung zum Verzehr.
Minski brüstet sich vor seinen Gästen, dass er die ganze Welt bereist und auf jedem Kontinent die schlimmsten Unsitten verinnerlicht habe – ein reisender Anthropologe auf der Suche nach infamer Menschlichkeit. Die Afrikaner hätten ihn letztlich den höchsten Genuss gelehrt, Menschenfleisch zu essen, den er mit der Quintessenz seiner anthropologischen Menschenkenntnis rechtfertigt: „die Selbstsucht [ist] alleinige Richtschnur für Recht und Unrecht“.[13] Minski hat erkannt, dass letztlich alles und jeder käuflich ist. Er macht sich dies zunutze, um die kannibalisch-sexuelle Tötungspraxis aufrechtzuerhalten, seine Reichtum und die geschickte Verstrickung politischer Herrscher in seine Untaten sichern ihm Freiheit von staatlicher Verfolgung.
Gefahr droht ihm nur, wenn er das rein geschäftliche Verhältnis zur Welt aufgibt und sich mit anderen Übeltätern wie Sades Protagonistin Juliette einlässt. Minski, der Juliette unter dem falschen Versprechen, ihr und ihrer Entourage nichts zu tun, in seine Burg lockt, scheint zuerst auch hier der Stärkere zu sein: Nachdem er ihre Dienerin und einen Diener gegessen hat, ist auch sie nicht mehr sicher. Er erläutert ihr, dass seine Lust am Menschenfleisch größer ist als sein Respekt vor einer Geistesgenossin. Seine Philosophie gebietet ihm, jeden Kontrakt zu brechen, sobald er der Maximierung seiner Lüste im Weg steht. Aber Minskis selbstsichere Beredsamkeit provoziert Juliettes Hinterlist und erlaubt es ihr schließlich, ihn zu betäuben und mit seinen Schätzen zu fliehen. Am Ende sieht sich Minski also wieder auf seine monströs-urtümliche Seite, auf sein Polyphem-Sein zurückgeworfen.
Kannibalismus taucht in Sades voluminösem Werk nur hier als eingängige Praxis eines Individuums auf, dafür gleichsam als überzeichneter Gipfel der Libertinage, als das unmittelbare Zusammenfallen von Tod und Genus. Diese Zuspitzung, die satirische Züge trägt, hat einen entschiedenen Nachteil gegenüber der bereits grausamen Lebensform von Sades übrigen Libertins. Minski ist wie Polyphem zum gesellschaftlichen Umgang unfähig, seine Prahlerei entbehrt nicht der Lächerlichkeit. Er kann seinen Genuss, selbst wenn er es wie mit Juliette möchte, nicht teilen; am Vergnügen der anderen teilzuhaben, bleibt also gerade ihm, der andere sosehr bzw. zu sehr genießt, verwehrt. Minskis Schwäche ist nicht sein Zynismus, sondern dessen inkonsequente Umsetzung. Der erfolgreiche Zyniker ist derjenige, der seine unmittelbaren Triebe so kanalisiert, dass er all seinen Genüssen längerfristig frönen kann.
Penthesilea und Minski sind die ersten ihrer Gattung. Diese neuen Kannibalen behaupten ihr Tun als entschuldbar oder gar als richtig, weil es mit den Gesetzen der Vernunft vereinbar sei – nur welche Vernunft damit gemeint ist, dies unterscheidet sie voneinander wie von ihrer Umgebung. Sie zeigen auf, dass das gesellschaftliche Tabu suspendiert werden kann, wenn auch zu einem hohen Preis, denn sie sind letztlich nicht fähig, unter Menschen zu leben. Ihre kannibalischen Logiken verschlingen entweder, wie im ersten Fall, das eigene Leben oder, wie im zweiten Fall, alles Leben um sie herum. Doch dies sollte sich zusehends ändern: Der vernünftige Kannibale wird im 20. Jahrhundert lebens- und gesellschaftsfähig.
Der politisch-moralische Kontrakt: Vitalismus und Zynismus
Obschon die Schicksale von Minski und Penthesilea ihre Apologien des Kannibalismus letztlich unterminieren oder zumindest als problematisch überführen, sind ihre Geschichten keinesfalls als moralische Exempel zu verstehen. Während Penthesilea – wie schon die Bachantinnen in Euripides Bakchen – in einer Zone jenseits der Schuld ihre Tat begeht, wo die Macht des Körpers jede Moral suspendiert, lehnt Minski eine humanistische Moral ab und schwingt sich zu einem Philosophen der selbstsüchtigen Täuschung hoch.
Sade und Kleist schreiben in einem gesellschaftspolitischen Kontext, in dem die Hoffnung auf eine Verwirklichung humanistischer Ideale massiven Zweifeln gewichen ist. Die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege sind die ersten modernen politischen Umwälzungen, in denen höhere politische Ziele vor aller Augen in niederste Affekte umschlagen. Bezeichnend hierfür ist die Zentralstellung der Kannibalismus-Metapher: Dass nicht nur der Terror der Jakobiner, sondern jede gewaltvolle politische Bewegung ihre Kinder zu fressen droht, hat das Denken dieser Zeit grundlegend geprägt. Die vernünftigen Kannibalen verleihen dieser drastischen Erkenntnis Ausdruck. Im Lichte einer revolutionären Dialektik von gewalttätiger Selbstbehauptung, die in Selbstzerstörung mündet, ist Penthesileas Körperlogik auch eine Logik politischer Körper. Im Lichte einer Politik, die ihre Ideale beständig zugunsten ihrer egoistischen Interessen zu verraten bereit ist, bringt Minskis Verrat und nachträgliche Weigerung, verlässliche Kontrakte einzugehen, den Zynismus rücksichtsloser Machtstrukturen seiner Zeit zum Ausdruck. Diese manifestieren sich in den Waren- und Menschenströmen, die Minski zu dirigieren weiß, und die sich jenseits einer starren bürgerlichen oder aristokratischen Ordnung entfalten können. Er ist nicht, was Sades Figuren öfters nachgesagt wird, ein Repräsentant des siegreichen Kapitalismus seiner Zeit, sondern dessen Parasit: Die ‚humanen Ressourcen’, die er aus dem Arbeitsmarkt abfließen lässt, werden nicht produktiv gemacht, sondern der kapitalistischen Leistungs- und Gewinnlogik unwiederbringlich entzogen. Minski ist also gleichsam opportunistisch und subversiv, seine Frechheit ist der revolutionäre Wagemut, der – nach Peter Sloterdijks Definition des modernen Zynismus – „die Seiten gewechselt hat“.[14] Wie die bürgerlichen und protoproletarischen revolutionären Bewegungen seiner Zeit macht auch Minski Klassen- und Staatsgrenzen obsolet, im Gegensatz zu ihnen aber ist er nicht auf Seiten der Unterdrückten, sondern arrangiert sich mit den Unterdrückern gleich welcher Couleur.
Der Diskursstrang, welcher von der Figur Minskis ausgeht, lässt sich als eine Geschichte des politischen Zynismus, der strategischen Selbst- und Fremdverleugnung aus Egoismus verstehen, während der vitalistische Diskurs, der mit Penthesilea einsetzt, eine aufrichtige Selbstbehauptung, wenn nötig bis in den Tod imaginiert. Es ist nicht weiter erstaunlich, dass beide Diskurse etwas mehr denn hundert Jahre später, in der Zeit zwischen den Weltkriegen, am konsequentesten weiterentwickelt werden, als Kannibalismus eine erneute Konjunktur in den Künsten erlebt. Einerseits bemächtigten sich die Avantgarden der 1920er Jahre des Kannibalismus als subversive Gegenmetapher zur etablierten Kunst, sei es in Picabias Manifeste Cannibale Dada (1920) oder in Oswaldo Andrades Manifesto Antropófago (1928). Andererseits – und für unsere Fragestellung wichtiger – führt der Erste Weltkrieg insbesondere in Deutschland und Österreich zu einem intensivierten Nachdenken über die Frage nach der moralischen Rechtfertigung von Menschenopfern und grausamem Heldentum, unterfüttert von einer schon in der Vorkriegszeit einsetzenden Faszination für kannibalische Wilde und Serienmörder.[15]
Ist die Avantgarde am Kannibalismus als jenem Irrationalen und Primitiven interessiert, das es befreiend aufzuwerten gilt, so fragt der politisch-poetische Diskurs über den Menschenfresser nach dem rationalen Kern des Ungeheuren. In diesem Sinne beschreibt der Lebensphilosoph Theodor Lessing 1925 den Serienmörder Haarmann als ein „Stück Natur“,[16] das zwar einer landläufigen Logik und Moral entbehrt, jedoch eine erschreckend-faszinierenden Gesetzmäßigkeit des Lebendigen aufzeigt.
Auch wenn die (Selbst-)Behauptung kannibalischer Vernunft erst im 20. Jahrhundert in der Klarheit Sades und Kleists weitergeschrieben wird, hat der Kannibale dazwischen eine bedeutsame Veränderung durchlaufen. Der indigene Menschenfresser wandelte sich im Zuge seiner zusehenden Fiktionalisierung zu einer mehrdeutigen Figur, welche die klaren moralischen Wertungen echter und semifiktionaler Reiseberichte, Märchen und Schauergeschichten hinter sich zurücklässt. Diese Veränderung ist auf ein neues, kritisches Bewusstsein kolonialer Machverhältnisse zurückzuführen und lässt sich darum am frühesten in der englischen Literatur ablesen. Bezeichnend sind der Kannibale Queequeg in Melvilles Moby Dick (1851) – der freilich gut ist, obschon er Menschenfleisch isst – und mehr noch die kannibalischen „good fellows“ in Joseph Conrad Heart of Darkness (1899). Die schwarzen Begleiter, die dem Erzähler auf seiner Bootsfahrt dienen, besitzen zwar mit gespitzten Zähnen, simpler Sprache und urtümlicher Vitalität viele Zeichen des klassischen ‚Wilden’, erstaunen ihn jedoch durch ihre Zurückhaltung. In Zeiten größter Not verschonen sie die weiße Bootsbesatzung und fragen stattdessen, ob sie ihre Feinde am Ufer essen dürfen. Dass diese Szene sowohl als ambivalenter Aspekt von Conrads Rassismus,[17] wie auch als progressive Sicht auf die kulturelle Identität des Kannibalen ausgelegt wurde,[18] zeigt ihren problematischen Status: Während die Weißen in diesem Roman eindeutig keine Helden mehr sind, da ihrer ‚zivilisierten’ Ausbeutung genau die Zurückhaltung der Menschenfresser fehlt, scheinen die Schwarzen das Potential zu einem vitalen Heroismus aufzuweisen, das sogleich von ihrem Primitivismus kassiert wird.
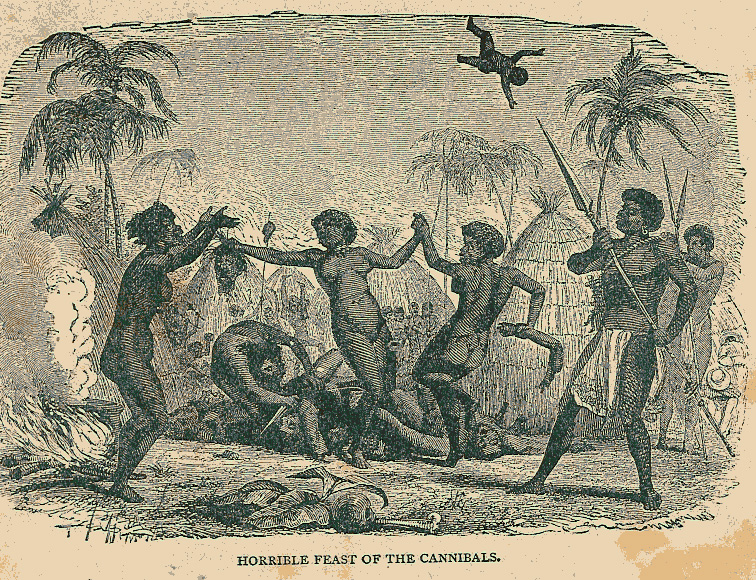
‚Horrible Feast of the Cannibals‘, Illustration zu Stanley’s Reisen in Afrika, 1848 von J. W. Buel.
Arthur Heyes Abenteuerroman Hatako. Das Leben eines Kannibalen (1921) zeichnet dagegen zweiundzwanzig Jahre später das Bild eines Helden, der seine vitale Ursprünglichkeit und seine westliche Bildung nach großem inneren Kampf in Einklang bringt. Der intelligente und tapfere Afrikaner Hatako kämpft am Kilimandscharo auf Seiten der deutschen Kolonialmacht gegen aufständische Einheimische, legt dabei aber zum Entsetzen seiner Vorgesetzten nie seine kannibalischen Gepflogenheiten ab. Die Zurecht- und Zurückweisung der Deutschen stürzt ihn in Selbstzweifel, die er erst überwindet, als er den gegnerischen Anführer besiegt hat, aber von seinen Mitsoldaten und Vorgesetzten verlassen auf dem einsamen Berggipfel des Kilimandscharo steht. In dieser pathetischen, auf Nietzsche verweisenden Schlussszene des Buchs erkennt der ‚Wilde’, dass der vermeintliche Geisterberg leer und verlassen und er ganz auf sich selbst zurückgeworfen ist: „Der Mensch auf der Gletscherzinne hob den Kopf, streckte die Arme zu den verlöschenden Sternen empor und ein Lachen voll bitterer, aber befreiender Erkenntnis übertönte den brausenden Gesang des Sturmes.“[19] Der Kannibale Hatako wird im Angesicht des Todes zum Übermenschen, der sich sowohl von seinem Aberglauben, als auch von der Moral der Kolonisatoren befreit hat: Er hat sich selbst aufgeklärt und ist nun fähig, die Aufklärung hinter sich zulassen.
Die Denkfigur eines positiv besetzten kannibalischen Vitalismus taucht im Diskurs der Zwischenkriegszeit immer wieder mit dezidiert zivilisationskritischen, aber politisch progressiven Absichten auf. So wünscht sich Thomas Mann etwa in seiner Fürsprache für die noch junge Republik eine ‚anthropophagische Kraft’, die sich im Kontext seines Gesamtwerkes ebenfalls auf Nietzsche und dort auf das Konzept des Dionysischen zurückführen lässt.[20] Obschon sich Nietzsche kaum für Kannibalismus interessierte, wird er nun zu einem Gewährsmann der affirmativen Funktionalisierung von Anthropophagie. Ironisch zugespitzt taucht ein solch vermeintlicher Nietzscheanismus etwa in Robert Musils Mann ohne Eigenschaften auf, wo gleich mehrere politische Seiten mit Kannibalismus argumentieren. Behauptet der Diplomat Hans Tuzzi, dass allein die westliche Diplomatie die Welt von der Menschenfresserei abhalte, wertet der Mystiker und Antisemit Hans Sepp den Tierkonsum gegenüber dem Verspeisen von Menschenfleisch ab und damit den Kannibalismus als urtümliche Praxis auf. Als dritte Position neben der zivilisatorischen und der vitalistischen ertönt mit General Stumm von Bordwehr eine zynische Stimme, die zivilisatorischen Fortschritt und Kannibalismus nicht als Gegensätze wertet: „Wenn sie mir die Zeitungen, den Rundfunk, die Lichtspielindustrie und vielleicht noch ein paar andere Kulturmittel überantworten, so verpflichte ich mich, in ein paar Jahren – wie mein Freund Ulrich einmal gesagt hat – aus den Menschen Menschenfresser zu machen.“[21]
Zu Beginn der 1930er Jahre, als Musil diese Worte niederschrieb, war der Vormarsch des Faschismus in Europa weit fortgeschritten. Der – im Falle Hatakos notabene schwarze! – Übermensch, der seinen Ort jenseits von Gut und Böse selbst schafft, ist nicht länger nur ein vitalistischer Abenteuertraum, sondern auch ein mit allen „Kulturmittel[n]“ der Zivilisation zynisch durchsetzbares Massenphänomen. Ernst Jünger verleiht dieser aufgeklärten Abgeklärtheit in seiner kurzen Erzählung Violette Endivien (1938) Ausdruck, in welcher Menschenfleisch ganz selbstverständlich in einer Metzgerei zum Verkauf angeboten wird. Der interessierte Ich-Erzähler quittiert die fachkundigen Ausführungen des Metzgers über die Menschenzubereitung lakonisch: „Ich wußte nicht, daß die Zivilisation in dieser Stadt schon so weit fortgeschritten ist.“[22] Die Erzählung wurde von Karl-Heinz Bohrer als Warnung vor dem Nationalsozialismus interpretiert,[23] dem Jünger kritisch gegenüberstand (und an dessen Angriffskrieg er später nichtsdestotrotz teilnahm). Der provokative Gestus des Erzählbandes Das abenteuerliche Herz, in dem der Text erscheint, legt eine andere Vermutung näher: Dass hier nicht ohne Genuss eine politisch-ästhetische Abgeklärtheit zelebriert wird, die ihre Enttäuschung über die Zeitgeschichte auf eine Weise kundtut, in der Satire ähnlich wie bei Sade schwerlich von Zynismus zu trennen ist.
Diese Ambivalenz zwischen satirischer und zynischer Rechtfertigung von Kannibalismus ist in den 1930er Jahren freilich nicht nur eine Sache der Rechten. Auf linker Seite aber äußert sie sich als Rückzugsgefecht. Walter Benjamin plädiert in seinem Essay über Karl Kraus (1931) dafür, dass das „klassische Humanitätsideal“ durch den „realen Humanismus“ des Unmenschen, d.h. des satirischen „Menschenfressers“, zu ersetzen sei.[24] Der Satiriker und sein Humanismus zeichnen sich freilich gerade dadurch aus, dass er das Unmenschliche nicht auf diejenige Art meint, mit der er es sagt, ja dass er genau das Gegenteil davon verfolgt. Benjamins selbst satirische Lobpreisung von Karl Kraus als „Menschenfresser“ verweist auf Jonathan Swifts Modest Proposal. Wenn Benjamin aber am Ende seines Kraus-Essays die kindliche Vernichtung des Bestehenden als letzte Aussicht auf eine positive Veränderung beschreibt, so blitzt darin eine Verbitterung auf, die bereits das Ende der Satiren ankündigt. Kann Humanität nur noch durch kannibalische Zerstörung hergestellt werden, scheint bereits (zu) vieles unrettbar. Benjamins Apologie der kannibalischen Unmenschlichkeit ist darum nicht länger als das satirische Uneigentliche, als Appell für ihr Gegenteil, zu verstehen. Der Kannibalismus Penthesileas, der befreit, in dem er zerstört, ist hier mitgedacht und in einen resignierend traurigen Zynismus überführt. Kraus selbst stellt nach der Machtergreifung Hitlers fest, dass es seiner „nicht mehr bedarf“,[25] da seine satirische Methode keine konstruktive Funktion mehr hat.
Als die politische Realität die Boshaftigkeit der Satire überholt hat, ist der Menschenfresser zusehends ein abgeklärter (Jünger) oder ein verzweifelter Zyniker (Benjamin). Umgekehrt ausgedrückt: Eine Satire, die ihre doppelbödige Distanz aufgibt und sich entweder auf die Seite des Gewinners oder des Verzweifelten stellt, ist vom Zynismus nicht mehr unterscheidbar. Gleichermaßen ist auch die vitalistische Vorstellung einer ‚anthropophagischen Kraft’, wie sie Thomas Mann am Anfang der Weimarer Republik imaginierte, in einem Zynismus aufgegangen, der sich eine solche Kraft nur noch wie Musils General Stumm von Bordwehr zu nutzen machen will. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird dem Kannibalen deshalb nicht mehr dieselbe affirmative Rolle einer politischen Lebenskraft zugedacht, die sie in der Zwischenkriegszeit einnehmen konnte.
Dessen ungeachtet rechtfertigen sich fiktionale Kannibalen weiterhin, nicht trotz sondern gerade aufgrund der Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Wie zuvor die Französische Revolution und der Erste Weltkrieg ist die neue Dimension menschengemachter Vernichtung eine Zäsur, die das Verhältnis von Kannibalismus und Aufklärung zu überdenken zwingt. In Georg Taboris Die Kannibalen (englische Erstaufführung 1968) töten und kochen jüdische Lagerinsassen ihre Mithäftlinge, weniger weil der Hunger sie dazu zwingt, als weil sie den biopolitischen Zynismus des Lagers verinnerlicht haben. Anstelle einer zu erwartenden Vertierung äußert sich dieser Zynismus höchst eloquent. So verteidigt sich der Jude Hirschler etwa mit den Worten: „Jetzt, in diesem Augenblick, wo du so viel Wind machst, sterben Millionen in Indien an Hunger; aber vielleicht sind wir heute zufällig auf die eleganteste Lösung gestoßen. Die Friedhöfe sind voll von Leckerbissen“.[26] Und sein Leidensgenosse Klaub setzt später den Gedankengang fort: „Fleisch ist Fleisch, und mein Vater im Himmel kann mich am Arsch lecken! […] In jeder Küche wird täglich gemordet!“[27]
Taboris Stück ist keine Satire, und schon gar nicht eine auf den Völkermord, denn dieser kann vom fiktionalen Kannibalismus weder überboten noch doppelbödig kommentiert werden. Stattdessen wird mit dem Mittel der Groteske ein Tabu angesprochen, das sich wohl nur mit dem Tabu des Kannibalismus vergleichen lässt: Opfer können auch Täter sein, weil die Vernunft des Überlebens – nicht nur als okkasioneller Hungerkannibalismus, sondern als soziales Prinzip – den Humanismus obsolet macht. Im Lichte der Judenvernichtung wird der Eigennutz eines Minski zum Kern eines zynischen Gesellschaftsvertrags, in dem Individuen letztlich ‚freiwillig’ mit den Machtstrukturen einiggehen, die definieren, wer ‚Fleisch’ und wer ‚Koch’ ist.
Der Kühlschrank Patrick Batemans in der Verfilmung von „American Psycho“ (2000)
Diese Abwertung des Menschen zu Fleisch sollte denn auch von einem Generalzyniker der neueren Literatur, Bret Easton Ellis Serienkiller Patrick Bateman in American Psycho (1991), propagiert werden, wenn er in seine weiblichen Opfer beißt: „[T]his girl, this meat, is nothing, is shit“.[28] Das System des Faschismus, in dem Kannibalismus sich nicht mehr grundlegend von anderen sanktionierten Gräueln unterscheidet, wird bei Ellis vergleichbar mit einem hyperkapitalistischen System, in dem alles Konsumgut ist und – einmal ‚erstanden’ – bedenkenlos weggeworfen werden kann. Die zynische Klimax des Romans stellt nicht eine alles überbietende Mordtat dar, sondern die stupende Realisierung des Mörders, dass er aufgrund seines Reichtums und sozialen Status’ wie schon Minski unbehelligt davonkommen wird. Auf den ersten Blick scheint es, dass Figuren wie Bateman den Warenfetischismus des Kapitalismus konsequent auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen, also nur noch in einer Abwägung von Kosten und Nutzen denken und sich weigern, ihr Gegenüber als menschliches Subjekt wahrzunehmen.
Obschon sich Bateman genau mithilfe dieser Logik rechtfertigt, vermag es sein Handeln nicht gänzlich zu erklären. Selbst im völlig deregulierten Kapitalismus ist sein Tabubruch – wie der Tabubruch der Häftlinge im unmenschlichen KZ-System – nicht einfach Symbol oder Satire der herrschenden Zustände, sondern stellt eine Reaktion auf diese dar. Dass faschistische und kapitalistische Ausnahmezustände Kannibalismus provozieren oder gar erlauben, heißt nicht, dass sie im selben Wortsinne kannibalisch sind wie Bateman oder Minski. Der Kannibale aber weiß sich in ihnen befreit; hier spielt er eine groteske Narrenrolle. Obschon Taboris Kannibalen eingeschlossen sind, erlangen sie in ihrem Treiben eine pervers-spielerische Unabhängigkeit. Umgekehrt wirkt Bateman gerade im losgelösten ‚anything goes’ des Yuppie-Lebens von den gesellschaftlichen Zwängen der Konsumkultur in die Enge getrieben. Sein Kannibalismus ist ein Mittel, dieses Beklemmen aufzubrechen. So unterschiedlich beide Situationen sind, lebt der zynische Kannibale doch jeweils denselben zerstörerischen Rest von Freiheit aus: Die Freiheit, von ‚wertlosen’ Körpern Gebrauch zu machen. Umgekehrt lässt sich die vitalistische Aufwertung des Körpers ebenso als spielerische Befreiung verstehen, denkt man an das Sprachspiel, mit dem Penthesilea ihre Rechtfertigung einleitet. Im kannibalischen Spiel wird der Ausnahmezustand, in dem sich der Kannibale bewegt und wo die Macht des Kriegs, des Faschismus oder des Kapitalismus ohne Restriktion herrscht, zugunsten seiner basalen Freiheit entkräftet, zur Rechtfertigung seiner Tat aber zugleich bekräftigt.
In diesem Sinne rekonstruiert auch der berühmteste Kannibale der Popkultur, Hannibal Lecter, sein Recht auf Menschenfleisch aus dem Ausnahmezustand des Zweiten Weltkriegs. Als kleiner Junge wurde der litauische Adlige von Nazikollaborateuren dazu gezwungen, die Überreste seiner Schwester zu essen. Dieses traumatische Erlebnis wird zur Grundlage sowohl seiner psychologischen als auch seiner philosophischen Motivation. Als Psychologe hat Lecter gelernt, die aggressiven Triebe, die das Trauma ausgelöst hat, in mörderische, aber kontrollierte Bahnen zu lenken. Lecter ist ein erfolgreicher Nachfolger Penthesileas, da er von der eigenen Körperlogik nicht überwältigt wird, sondern sich diese in einem sozialdarwinistischen Sinne zunutze macht – wenn die Welt ihn schon zu einem Tier gemacht hat, will er immerhin dessen stärkstes Raubtier sein. Das kindliche Trauma führt zur Erkenntnis, dass jegliche Moral relativ sei und macht ihn so zu einem Wiedergänger Minskis. Wiederum anders als Minski aber kann Lecter seine Genüsse tatsächlich teilen, er ist gesellschaftsfähig. Erst die Anerkennung seiner Kochkünste durch nichtsahnende Gäste befriedigt ihn gänzlich. Darüber hinaus sucht er sich Gefährten und Gefährtinnen, die bewusst an seinen kulinarisch-intellektuellen Mordspielen teilhaben. In seiner Rechtfertigung einzelner Morde gehen ästhetisch-kulinarische und sozialdarwinistische Argumente ineinander über. Laut Lecter haben seine Opfer ihren Lebenswert verspielt, indem sie sich unflätig oder bösartig – was in seinen Augen auch bereits bedeuten kann: nicht elegant genug – verhalten haben: „Whenever feasible, one should eat the rude.“[29] Als überlegenes Raubtier ‚reinigt’ Lecter die Gesellschaft von einem ästhetischen Makel und transformiert ihn in einen kulinarischen Genuss, den es wiederum mit ausgewählten Ästheten zu teilen gilt.
Hannibal Lecter bereitet das Hirn seines Widersachers zu. Verfilmung von „Hannibal“ (2001)
Lecter ist nur auf den ersten Blick eine unpolitische Figur. Seine Beliebtheit, die seit seinem ersten Auftauchen in Thomas Harris Roman Red Dragon (1981) durch zwei weitere Bücher, vier Filme und eine Fernsehserie kontinuierlich gesteigert wurde, lässt sich auf eine klug inszenierte Attraktivität des Zynischen zurückführen. Der Über-Unmensch Lecter wird zu einer ambivalenten Projektionsfläche politischer Unkorrektheit. Zwar kritisiert er als Gentleman und Connaisseur die scheinbar unzivilisierte Massen- und Konsumkultur (deren erfolgreiches Phänomen die Figur selbst ist), setzt dieser jedoch keine humanistischen Ideale entgegen, sondern einen zutiefst egoistischen Konsumenten-Dünkel. Der Germanist Christian Moser hat darum an den Lecter-Romanen und -Filmen kritisiert, dass der kapitalistische ‚Warenkannibalismus’, die Verdinglichung menschlicher Beziehungen, durch sie eine Apologie wiederfahre.[30] Insofern sich diese Kritik auf die Rechtfertigungsstrategie Lecters begrenzt, ist sie berechtigt, sie geht jedoch fehl, wenn Moser auf Thomas Harris’ Werk als Ganzes zielt. Erstens gilt auch für Lecter, dass seine Taten einen Spielcharakter haben, der auf einen sozialen Ausnahmezustand reagiert. Sie sind eine Zuspitzung und eine Befreiung von Machtstrukturen. Auch wenn ohne sie undenkbar simuliert seine Konsumlogik gerade nicht diejenige der nationalsozialistischen Ideologie oder des entfesselten Marktes, sondern bedient sich dieser auf parasitäre Weise. Zweitens erzeugt Lecters Spiel moralische Ambivalenzen. Wenn er auch Unschuldige und Unbeteiligte tötet, stürzt er nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Leser in Gewissenskonflikte. Er gebärdet sich weniger als nietzscheanischer Held im Sinne Hatakos, denn als mephistophelischer Verführer.
In zweihundertjähriger Kontinuität erscheint Lecters Rechtfertigung als konsequente Fortsetzung und Synthese mechanistischer und vitalistisch-darwinistischer Körperbilder, mit denen auf bewusst dilemmatische Weise gespielt wird. Dadurch bleibt es offen, Lecter als problematischen, aber auch problematisierenden Ausdruck aufgeklärter Tendenzen, oder platterdings als positiv intendierte Figur zu betrachten. Dass es Rezipienten gibt, die letzteres tun, macht eine eingehende Untersuchung im ersteren Sinn umso notwendiger.
Wenn die Figur Lecters heute beispielsweise auf dem neonazistischen Blog daily stormer, einem Leitorgan der faschistoiden alt-right-Bewegung, adaptiert wird, indem der Autor Michael Collins ihm antisemitische Monologe und Witze in den Mund legt („Kosher food is best right from the oven“),[31] so folgt dies natürlich nicht der Intention seines Autors Thomas Harris und der Regisseure, die Harris Romane adaptiert haben. Es verweist aber auf eine Problematik, die von Bret Easton Ellis direkt adressiert wird: Der fiktionale und außerfiktionale Erfolg der Kannibalen-Figur in der Populärkultur liegt letztlich nicht in seiner bewundernswerten Andersartigkeit (die sich auch Bateman lange zuschreibt), sondern ist Ausdruck einer Gesellschaft, welche den aufgeklärten Kannibalismus als Spielart ihres eigenen auf- und abgeklärten Zynismus genießt.
Hannibal Lecters Adaption durch eine neue faschistische Rechte ist das Resultat eines moralischen Kontraktes, welcher um der Ästhetik bzw. um des Genusses willen Menschlichkeit für nichtig erklärt. Die alt-right schließt auf erschreckende Weise den Kreis zu Taboris Die Kannibalen: Lecter, ein Opfer des Faschismus, wird hier zum faschistischen Täter – nicht als groteske Figur, welche die Perversion des Faschismus aufdeckt, sondern als affirmierter Vorkämpfer eines solchen Systems. Damit hat sich die Figur Lecters maximal von der humanistischen Satire Jonathan Swifts entfernt, die am Anfang der zynischen Kannibalenfiguren stand und die bei de Sade und Jünger zumindest als Ambivalenz zwischen gesellschaftskritischer Satire und abgehärtetem Zynismus nachwirkte. Selbst Thomas Harris’ Lecter bleibt in seiner mephistophelischen Attraktivität noch ein Zerrspiegel, der mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Seine faschistische Vereinnahmung aber nimmt die Unmenschlichkeit des Kannibalen gerade im Witz todernst.
Damit sind wir, wie angekündigt, erneut an einem Punkt angelangt, an dem sich Fiktion derart mit Realität vermischt, dass sie nicht länger aus angenehmer Distanz betrachtet werden kann. Der Kontrakt Lecters, den gewisse Menschen nur allzu gern für bare Münze nehmen, verweist auf die prekäre Aufklärung unserer eigenen Zeit, in der demokratie- und humanismusfeindliche Moralvorstellungen ähnlich wie in den 1930er Jahren eine gefährliche Konjunktur feiern. Sie tun dies gerade auch unter dem Banner einer neuen vernunftgeleiteten, aber abgeklärten Aufklärung, die sich überlegen fühlt, weil sie vermeintliche Ideologien hinter sich gelassen glaubt.
Der ästhetische Kontrakt: Drastikgenuss als Selbsterkenntnis
Will man die Faszination verstehen, die von Hannibal Lecter und seinesgleichen vernünftigen Kannibalen ausgeht, ist es mit einer Untersuchung ihrer expliziten moralischen Rechtfertigung nicht getan. Die Apologie solcher Figuren verläuft über eine drastische Ästhetik, die sowohl für den fiktionalen Kannibalen und seine Gefährten, als auch für seine realen Rezipienten einen eigentümlichen Genuss darstellt. Das ästhetische Erleben von Drastik geht zwar Hand in Hand mit der Moral des Menschenfressers, leistet aber eigenständige Erklärungs- und Überzeugungsarbeit.
Dietmar Dath behauptet, dass sich Drastik-Fans durch ihren Konsum von Horror- und Splatterfilmen primär einer Mutprüfung unterziehen. Sie würden eine Abhärtung ihrer Sehgewohnheiten verfolgen, eine subversive Einübung in die endlich offen dargestellten Härten eines heuchlerischen kapitalistischen Systems. Auf dieser Zielgerade seines politischen Arguments entgehen Dath intrikate ästhetische Aspekte. Der Genuss des Konsumenten besteht nicht alleine im Metagenuss seiner eigenen Stärke, das Grässliche zu ertragen. Die drastische Darstellung und die starken, durch sie hervorgerufenen Gefühle werden ebenso selbst genossen – ansonsten verflöge das Interesse am Drastischen nach einiger Zeit unwiederbringlich. Drastik wäre gleichsam nur eine quantitative Eigenschaft, die sich alleine am Grad ihrer Explizitheit, an ihrer Differenz zum Nicht-Drastischen messen ließe, ohne ein eigenes ästhetisches Ideal darzustellen. Eine ‚gute’, d.h. qualitativ ansprechende, Drastik entsteht aber nicht durch die größtmögliche Steigerung des mörderischen Gräuels, der sexuellen Perversion oder sonstiger körperlicher Explizitheiten. Gerade die sinnliche Reizung ohne Unterbrechung kann auch für den größten Drastik-Enthusiasten schnell langweilig werden.
Zu den wichtigsten Beispielen, mit denen Dath sein Ideal illustriert, gehören Ellis American Psycho, Lucio Fulcis Splatterfilm Beyond und der erotische Kannibalenfilm Trouble Every Day von Claire Denis. Dass das erste und letzte Beispiel Darstellungen von Kannibalismus enthalten, ist kein Zufall und soll weiter unten eingehender analysiert werden (übrigens impliziert auch Fulcis Film Kannibalismus durch das Auftauchen von Zombies). Alle drei Beispiele zeichnen sich keinesfalls durch einen Überbietungsgestus aus, der für Daths Abhärtungsthese sprechen würde. Die exakte, unaufgeregte Sprache von American Psycho führt ohne Effekthascherei in eine Welt der Grausamkeit ein und geht eben durch ihre scheinbar oberflächliche Präsentation verstörend nahe. Umgekehrt wird in Beyond das Außergewöhnlichste auf quasi-religiöse Weise zelebriert, jede Horrorszene ist eine Innovation körperlicher Gewalt.
Aufgrund dieser Überhöhung und Alleinstellung (nicht aber quantitativen Steigerung!) des Schreckens interpretiert Dath den Film denn auch als eine Allegorie des Drastischen selbst. Der Einfallsreichtum Fulcis ist verweisreich, da er sich an Darstellungen des Surrealismus oder der christlichen Ikonographie orientiert, und bleibt doch immer ganz nah am Körper; seine bevorzugte Verstümmelung, das aufgeschnittene oder herausgerissene Auge, macht im übertragenen wie im körperlichen Sinne das Schmerzliche sichtbar. Trouble Every Day letztlich bedient sich der Ästhetik des französischen Autorenkinos, arbeitet mit langen, ruhigen Einstellungen und vielen Close-Ups. Das Werk schafft dadurch Figurenstudien, die für den Horrorfilm und insbesondre die Untergattung des Kannibalenfilmes ungewöhnlich sind. Verstörend sind hier nicht alleine die blutreichen Darstellungen, die gore mit Erotik vermischen, sondern insbesondere die psychologisch-libidinösen Konflikte, die mit ihnen einhergehen.
Trailer zu Claire Denis‘ „Trouble Every Day” (2001)
So unterschiedlich die drei Beispiele sind, die sich vereinfacht als Normalisierung, Überhöhung und Erotisierung/Psychologisierung von expliziter Gewalt typologisieren ließen, haben sie doch den Effekt gemeinsam, dass das Gezeigte für den Zuschauer in erhöhtem Maße vorstellbar und sinnlich nachfühlbar wird. Drastik hat primär also nichts mit Abhärtung, sondern mit Einfühlung zu tun. Selbst wenn man sich mit der Zeit an Gewaltdarstellungen gewöhnt, ist gerade diejenige Darstellung, die uns noch gegen den eigenen Willen etwas fühlen lässt, die drastischste. Zugegeben, diese unabweisbare Nach- und Einfühlbarkeit ist kein Alleinstellungsmerkmal von Drastik, sondern wurde als rezeptionsästhetisches Kriterium immer wieder für jegliche Kunst eingefordert. Wenn etwa Térezia Mora meint, ein „wahrhaft drastischer Satz“ sei einer, „der mir keine Chance lässt, die in ihm enthaltene Wahrheit zu leugnen“,[32] so hat sie zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für den von Drastik angestrebten ästhetisch-aufklärerischen Effekt benannt. Mora schließt, dass alle Kunst drastisch sein müsse. Will man dieser Generalisierung nicht folgen, gilt es nach der spezifischen Leistung von Drastik zu fragen.
Die Affekte, die mit dem expliziten Zeigen bzw. Beschreiben von Körperlichkeit einhergehen, sind Schmerz, Ekel und Lust. Der Effekt von Drastik steht damit zweifellos in der Tradition verschiedener Katharsis-Theorien, mit dem entscheidenden Unterschied, dass Drastik mit ‚Rührung und Schrecken’ nicht länger eine ‚Reinigung’ des Zuschauers vom bzw. durch den Affekt anstrebt.[33] An Stelle einer therapeutischen Wirkung ist die Auseinandersetzung mit den Affekten selbst getreten. Drastische Lust ist darum kein positiv-rührendes Wohlgefallen, sondern eine (selbst)zerstörerische, ja dionysische Befriedigung.
Abhängig von der Position, aus welcher ein Text oder Film den sinnlich-kognitiven Nachvollzug seiner „Wahrheit“ (Mora) aufdrängt, scheint ein Affekt zu überwiegen. Die Sicht des Opfers vermittelt dem Zuschauer Schmerz, die Sicht des Täters Zerstörungslust, eine tendenziell neutrale Außensicht Ekel. Diese Trennung kann aber nur ein heuristisches Mittel sein. Wie die oben ausgeführten Beispiele veranschaulichen und wohl an allen drastischen Werken zu zeigen wäre, tauchen die drei Affekte immer zeitgleich auf. Das Herausreißen eines Auges in Beyond ist überwiegend ein schmerzhafter, zugleich aber auch ein ekelhafter und ein lustvoller Anblick, im selben Sinne wie das Abkratzen von Schorf oder das Ausdrücken von Pusteln schmerzlich, eklig und doch zutiefst befriedigend sein kann. Im ästhetischen Zusammenspiel sind Schmerz und Ekel wie die Zerstörungslust Quellen eines ambivalenten Genusses: Der Zuschauer wird bei körperlicher Unversehrtheit zum Masochisten und Sadisten am eigenen Körper. Er erhält die Möglichkeit, seine Affekte auf eine Weise zu erleben, die ihm in außerfiktionalen und außerdrastischen Kontexten verwehrt bleibt. Drastik ist folglich eine Form der Selbsterkenntnis mithilfe von Affekten, die normalerweise vermieden werden.
Ausschnitt aus Lucio Fulcis „Beyond“ (1981)
Es ist schwierig, explizit über Kannibalismus zu sprechen, ohne drastisch zu werden. In der Geburtsstunde des aufgeklärten Kannibalen um 1800 wird der ursprünglich medizinische Begriff ‚Drastica’, der ein starkes Abführungsmittel bezeichnet, durch Friedrich Schlegel ins Feld der Ästhetik übertragen.[34] Auch wenn für diese Übertragung noch eine zweifelhafte kathartischen Reinigung durch die Kunst maßgebend war, betont sie im Gegensatz zu früheren Katharsis-Theorien die Körperlichkeit der ausgelösten Affekte. Kunst ist hier ein ‚Drastica’, das gegessen bzw. geschluckt werden kann und das in einer heftigen, zuweilen schmerzhaften und nicht minder ekligen körperlichen Reaktion Befriedigung verschafft. Schlegels Interesse für die sinnbildliche gastrisch-körperliche Reaktion durch Kunst steht das Interesse für explizite körperlich-gastronomische Reaktionen in der Kunst bei Kleist oder Sade gegenüber: Kannibalismus erscheint so gleichsam als das logisch-historische Komplement zur Drastik.
Freilich existierten schon vor 1800 explizite Kannibalismus-Darstellungen und Werke, welche die heutigen Kriterien für Drastik erfüllen (man denke etwa an Shakespeares Titus Andronicus, in dem beides eine zentrale Rolle spielt). Die gleichzeitige Konjunktur und geistige Unterfütterung beider Phänomene um 1800 verweist nichtsdestotrotz auf einen inneren Zusammenhang: Kannibalismus ist das drastische Thema schlechthin, weil es immer eine Ursache von Ekel und Schmerz darstellt, insofern von den Opfern die Rede ist, aber genauso unter dem Aspekt von Genuss betrachtet werden muss, wenn die Sprache auf den Täter kommt. Nicht zufällig tauchen in vielen, wenn nicht den meisten Beispielen Dietmar Daths Kannibalen auf. Drastische Künstler nehmen sich des Kannibalismus als Thema an, weil es sich in doppelter Hinsicht für ihr Tun eignet. Auf wirkungsästhetischer Seite löst das Tabu des Kannibalismus im Publikum zielsicher die angestrebte Gefühlsmischung aus Ekel, Lust und Schmerz aus. Auf poetologischer Seite veranschaulicht Kannibalismus die Funktion von Drastik selbst: In kannibalischen Kochkünsten und im Verzehr von Menschenfleisch spiegeln sich die Handlungen des Drastikproduzenten und -konsumenten. Wie der Menschenkoch und der Menschenfresser schaffen und genießen sie das vermeintlich Ungenießbare.
Die betrachteten Werke über aufgeklärte Kannibalen sind spezifische Ausprägungen dieser drastischen Ästhetik; indem sie den Genuss der Menschenfresser besonders betonen, verwenden sie Drastik gezielt in ihrer Funktion eines alternativen Erkenntniswegs. Nicht nur macht Drastik die gastronomische und erotische Zerstörungslust des Menschenfressers jenseits seiner philosophisch-moralischen Rechtfertigung intelligibel, sie zwingen auch den Leser oder Zuschauer dazu, sich mit dem eigenen Genuss und seinen destruktiven Komponenten auseinanderzusetzen. Die gesellschaftliche Relevanz von Zynismus und Vitalismus, die im Kannibalen zu prekären Zeiten immer wieder zum Ausdruck kommt, erweist sich damit auch als ein Phänomen des Affekts. Denn von Zynismus und Vitalismus geht ein tabuisiertes Genussversprechen aus: Die unbändig-rohe Lebenskraft oder die gewissenlose Frechheit ermöglichen den lustvollen Ausbruch aus dem engen Korsett sozialer Triebkontrolle. Mit dem Kannibalen zusammen bzw. durch die Sinne des Kannibalen hindurch kann der Leser oder Zuschauer nicht nur eine politisch-moralische Befreiung aus einer politischen Realität, sondern auch eine ganz basale, lustvolle Selbstbefreiung außerhalb seiner privaten Realität erfahren. Freilich kann er dies tun – und meist tut er es genau deshalb –, ohne die erfahrene moralische Grenzüberschreitung per se gutheißen zu müssen. Dass dies stellvertretend der Kannibale für ihn tut, bildet den Kern seines ästhetischen Kontraktes. Der aufgeklärte Menschenfresser fordert Verständnis und bietet im Gegenzug einen ambivalenten Genuss.
Diese zwar vernünftige, aber moralisch gleichgültige Tauschbeziehung läuft dem positiven Aufklärungsauftrag, den Dath drastischen Werken zuschreibt, zuwider. Daths Abhärtungsthese soll vor dem verbreiteten Vorwurf schützen, dass drastische Kunst ihre Rezipienten zu gewalttätigen Individuen macht. Sowohl Vorwurf als auch Verteidigung greifen aber zu kurz; sie übersehen beide, wie Drastik primär auf seine Rezipienten wirkt bzw. wozu sie von diesen konsumiert wird: sie erlaubt, mit gesellschaftlich unterdrückten Affekten konfrontiert zu werden, die zugleich ein verstecktes movens ihrer Gesellschaft sind. Insofern eine drastische Aufklärung eigene und kollektive Affekte dingfest macht, sind diese Affekte, und damit auch diese Form der Aufklärung, weder gut noch schlecht.
Die betrachteten Darstellungen von Kannibalismus wurden in den meisten Fällen nie als handlungsanleitend betrachtet, trugen aber genauso wenig zur Bewusstseinsbildung über soziale Ungerechtigkeiten bei – abgesehen vielleicht von explizit satirischen Kannibalismus-Darstellungen wie Jonathan Swifts Brieffiktion A Modest Proposal oder der Anarcho-Rockfilm Eat the Rich. Oft hat die fiktionale Rechtfertigung des Kannibalen, wie gesehen, einen impliziteren Zusammenhang mit politischen Idealen ihrer Zeit. Diese werden nicht offen angeprangert, sondern im gesellschaftlich undenkbarsten, und doch basalsten zwischenmenschlichen Kontakt ausagiert: Wo sich Menschen essen, ist das höhere politische Ideal in eine Politik der Körper (bzw. mit Foucault und Agamben: in Biopolitik) aufgegangen. Der Zynismus in Ernst Jüngers Violette Endivien veranschaulicht keinen politischen Diskurs, sondern bricht diesen auf einen drastischen Effekt herunter. Der Text kann nicht unmittelbar handlungsanleitend sein, weil seine Aussage zutiefst ambivalent bleibt, während die Szenerie im Feinkostladen wiederum die ambivalente Erfahrung von Lust, Ekel und Schmerz evoziert. Eine zentrale Leistung drastischer Apologien von Kannibalismus ist also, dass sie ein politisch-moralisches Problem ästhetisch erfahrbar machen, ohne dessen Lösung vorzugeben.
Die Transformation des Politischen ins Ästhetische und des Diskursiven ins Basale macht das Politische oder das Diskursive nicht bedeutungslos, ansonsten ließe es sich nicht als solches rekonstruieren. Aber es überblendet diese Kontexte zugunsten eines kurzzeitig überwältigenden Gefühls. Was Dath also für die story des drastischen Werks festgestellt hat, dass der Handlungsverlauf nämlich durch den drastischen Effekt überstrahlt wird, gilt auch für die größeren sozio-politischen Zusammenhänge, in denen das Werk als Ganzes steht. So wie ein stechender Schmerz uns für einen Augenblick vergessen macht, wo wir uns befinden, sehr wohl aber auf diese Umstände zurückzuführen ist, fungiert Drastik, um ein Bild Kafkas zu verwenden, als „Axt […] für das gefrorene Meer in uns“.[35]
Wohlgemerkt fordert Kafka, dass die Funktion dieser ‚Axt’ Büchern zukommen soll, „die einen beißen und stechen“.[36] Das beißende Buch als Unglück, „das uns sehr schmerzt“,[37] vereint nicht zufällig Aspekte des Kannibalischen und des Drastischen. In Kafkas Werk ist der Menschenfresser eine Komplementärfigur des Hungerkünstlers. Genießt dieser im gleichnamigen Text Der Hungerkünstler (1922) seinen ultimativen Rückzug aus dem Leben, so entspricht der Kannibale, der in einer lange unpublizierten Vorstufe des Textes auftaucht, einem lebensbejahenden Prinzip. Er strebt eine ‚beißende und stechende’, unmittelbare Lebenserfahrung an. Damit lässt sich dieser Menschenfresser leicht in die Reihe vitalistischer Kannibalen mit jener unbändigen Lebenskraft einreihen, welche von Thomas Mann ebenfalls im Jahr 1922 politisch eingefordert wurde. Kafkas Figur weist jedoch auf einen epistemologischen Aspekt hinter dieser zeittypischen Sehnsucht nach Leben hin. Gerhard Neumann hat gezeigt, dass die Figur des Menschenfressers bei Kafka das ästhetische und erkenntnistheoretische Ideal einer „antisymbolischen“[38] Sprache erfüllt. Er sei ein „Versuch, aus dem Feld der Metaphern in eine Welt unbezweifelter Bewahrheitung zurückzukehren, wie sie das Paradies vor dem Sündenfall, vor der Spaltung von Zeichen und Körper, vor der Erfindung von Liebe und Tod darstellt.“[39] Der Kannibale vollzieht hier – und nicht nur hier – eine Annäherung an ein Ideal von Unmittelbarkeit schlechthin.
Der Kontrakt über die gemeinsame Erkenntnis: Die profanierte Kommunion
Wie kaum ein anderes fiktionales Werk über Kannibalismus arbeitet Slavenka Drakulićs Roman Das Liebesopfer (dt. 1998) eine solche Annäherung an die Immanenz von körperlicher Erfahrung heraus. An ihrem Text konkretisiert sich nicht nur Kafkas Andeutung gebliebener Antisymbolismus, Das Liebesopfer legt eine Bedeutungsschicht frei, die Fiktionen aufgeklärter Anthropophagie zwar durchwegs eigen ist, sich aber selten konkret an Text und Bild äußert. Drakulić dagegen stellt die Frage nach einem kannibalischen Erkennen ins Zentrum ihres Werkes. Ihre Kannibalin beruft sich auf moralische und ästhetische Kontrakte, wie sie ähnlich bereits herausgearbeitet wurden und auch für ihren Fall im Folgenden nachgezeichnet werden. An Liebesopfer lässt sich darum gleichsam eine abschließende summa der bisherigen Betrachtungen durchführen. Darüber hinaus aber geht diese Kannibalin einen Schritt weiter und schlägt dem Leser einen Kontrakt über die gemeinsame Erkenntnis vor.
Der Originaltitel Božanska glad (1995) ist wort- und werkgetreuer mit „Der göttliche Hunger“ zu übersetzen; mit einem solchen Hunger rechtfertigt sich die Protagonistin, eine polnische Doktorandin der englischen Literatur. Während eines Forschungsaufenthaltes in New York tötet und isst sie ihren brasilianischen Liebhaber. Als späte Nachfolgerin Penthesileas hat sie ihre Schuld schon ausgeräumt, bevor sie den Mord an José begeht. Der ist zwischen seiner amour fou zur Protagonistin und seiner Pflicht gegenüber Frau und Kind derart zerrissen, dass er in eine schwere Depression fällt. Als sein Lebenswille zusehends schwindet, glaubt die Geliebte ihre unmöglich werdende Liebe auch seinetwillen nur noch durch seine Einverleibung retten zu können. José – der eine wissenschaftliche Arbeit über Kannibalismus schreibt und der Protagonistin damit unwissend die Idee zur Tat eingibt – scheint der kannibalischen Vereinigung zuzustimmen. Umgekehrt glaubt sich die Erzählerin nach seinem Verzehr nicht nur im Besitz des Liebhabers, sondern auch als dessen Eigentum: „Mein Gedächtnis, meine Gefühle, mein Fleisch, ich selbst, das alles gehört nun ihm, ist sein.“[40] Neben diesem impliziten moralischen Kontrakt mit ihrem Opfer verteidigt sich die Erzählerin, indem sie auf die Einzigartigkeit ihrer Liebe verweist und damit einen Ausnahmezustand reklamiert, der ihr erlaubt „das höchste Gebot“ zu überschreiten – „und das befreit einen von der Verantwortung, ein Mensch zu sein und sich an die Gesetze des Menschen zu halten.“[41]
Politisch bedeutsam ist diese Grenzüberschreitung angesichts des Ausnahmezustandes, welchen die junge Polin sowohl individuell in Amerika, wie auch als Teil jenes Kollektivs erlebt, das nach dem Untergang des Ostblocks plötzlich mit den vermeintlichen Freiheiten des Westens konfrontiert ist. Ihre bedingungslose Liebe wendet sich einem anderen Außenseiter zu, José erscheint ihr als Brasilianer mit indianischen Vorfahren geradezu modellhaft exotisch. Ausgerechnet der noch Fremdere also, mit dem sie sich nur schwer verständigen kann, hilft ihr, das anfängliche Verlorensein in Amerika zu überwinden. Seine Einverleibung folgt der subversiven Strategie, die eigene kulturelle Identität mithilfe der größten Abweichung, dem Inkorporieren des Fremden, zu behaupten. Das Gegenteil dieser Selbstbehauptung verfolgt, wie wir gesehen haben, der zynische Kannibale, der sich mit den herrschenden Machtstrukturen bis zur Selbstverleugnung arrangiert um aus ihnen den größten Genuss zu schöpfen.
Die Ich-Erzählerin hat wie Penthesilea ein vitalistisches Verhältnis zum eigenen und fremden Körper. Im Gegensatz aber zur überwältigenden Körpervernunft der Amazone, die den gordischen Knoten in einem Moment der Bewusstlosigkeit durchschlägt, versucht die Ich-Erzählerin ihren Körper als eigenständiges Subjekt zu verstehen und seinen Bedürfnissen Folge zu leisten. So beschreibt sie bereits den Beginn der Liebesbeziehung als eine autonome Reaktion des Körpers: „Meine Haut erkannte ihn, als hätten wir einander schon berührt.“[42] Im Moment, da sie sich ihr sexuelles Bedürfnis eingesteht, erlangt sie ein vollständiges Körperbewusstsein: „Ich kehrte zurück in meinen Körper, in die Leidenschaft, in mich selbst.“[43] Im Rückblick führt die Ich-Erzählerin den Leser zusehends näher an die Gründe für ihr Handeln heran; wenn sie letztlich mit drastischer Genauigkeit beschreibt, wie sie den Mann ihres Lebens erstickt und zerstückelt, löst dies keinen Schockeffekt mehr aus, sondern bewirkt, wie Ralph Dutli konstatiert, jenes ambivalente, erschrockene „[S]chwindeln“,[44] das auch die Protagonistin befallen hat. Als sie unmittelbar nach der Tat in den Spiegel blickt, schreckt sie vor ihrem blutverschmierten Antlitz zurück. Aus Schmerz, Ekel und aufkommender Lust erwächst ihr jedoch – und abgeschwächt auch dem mitfühlenden Leser – eine religiös anmutende Euphorie, ein Staunen über ihren Mut, real werden zu lassen, was zuerst nur Phantasie war. Die Rhetorik des Textes verstärkt diesen Effekt, indem sie den Leser über eine Vielzahl von Andeutungen und Kannibalismus-Metaphern zur Tat hinführt.
Indem der Symbolismus der Tat erklärend vorweggenommen wird, erscheint sie nicht mehr als Symbol, sondern als dessen Überwindung hin zum Eigentlichen. Der Kannibalismus der Ich-Erzählerin bedeutet im Moment seiner Ausführung nichts mehr außerhalb seiner selbst; wo alles schon gesagt ist, tritt das Zeichen in den Hintergrund – genauer noch: Das Zeichen und das Bezeichnete fallen zusammen, weil zwischen Symbolwirkung (einem Ausdruck der tiefsten, liebenden Aneignung) und Körperwirkung (dem tatsächlichen Aneignen des Geliebten) nicht länger unterschieden werden kann. Dass die Erzählerin das Verspeisen von José darum mit der christlichen Kommunion vergleicht, ist nicht alleine auf ihre katholische Erziehung oder ähnliche Vergleiche in der Geschichte des Kannibalismus[45] zurückzuführen. Im Abendmahl verschmelzen der übertragene Sinn und das Faktische untrennbar: Die Hostie steht nicht nur für, sondern ist der Leib Christi. Der Gläubige erhält kein symbolisches Substitut, sondern kostet und erkennt – sapere aude! – das Göttliche. Doch anders als die Hostie, die erst durch Gottes Kraft in der Transsubstation zum Leib Christi wird, musste der Körper Josés keine solche Wandlung durchmachen. Die Kommunion der Kannibalin ist profaniert und entmystifziert, keine Magie und kein Geheimnis hängt ihr noch an. Eine Kommunion ist der Akt letztlich auch im Sinne der Gründung und Wahrung einer Gemeinschaft (‚communio’) zwischen den Liebenden und dem Leser: Der mitfühlende Leser wird hier ähnlich dem gläubigen Zeugen in eine Erfahrung eingebunden, welche die menschliche Sehnsucht nach Ganzheit nicht in einer transzendentalen Metaphysik, sondern durch einen konkreten Körper erfüllt.
Rückblickend lässt sich eine Entmystifizierung des Abendmahles wiederfinden in Penthesileas Beharren auf der buchstäblich-kannibalischen Dimension ihrer Liebe, in Hatakos nietzscheanischer und d.h. antimetaphysischer Wandlung zum Übermenschen (als welcher Hannibal Lecter immer schon auftritt) oder bei Georg Taboris KZ-Häftlingen, die ihrem Gott abschwören, wenn Sie wie Patrick Bateman behaupten, ‚Fleisch’ sei ‚Fleisch’. Obschon diese Beispiele entgegengesetzte Ziele verfolgen, nämlich eine vitalistische Aufwertung oder eine zynische Abwertung des menschlichen Körpers, so ist ihnen doch dies gemeinsam: In ihnen fallen – wie in Das Liebesopfer – Zeichen und Bezeichnetes im Körper zusammen.
Es griffe zu kurz, darin lediglich eine semiotische, d.h. zeichentheoretische Implikation des modernen Kannibalismus auszumachen. Dessen aufklärerischer Impetus besteht vielmehr in einer für die Neuzeit typischen, aber hier zugespitzten Profanierung, wie sie Giorgio Agamben in Rückgriff auf Walter Benjamin skizziert hat. Agamben unterscheidet zwischen Säkularisierung und Profanierung: Letztere überträgt nicht einfach die Macht des Heiligen in weltliche Repressionszusammenhänge, sondern reinigt ein Objekt von der Sphäre religiöser Macht und gibt es dem freien Gebrauch des Menschen zurück. Agamben veranschaulicht dies am römischen Opfertier, das zwar für den Gott geschlachtet wird, aber nur teilweise auch für das Brandopfer vorgesehen ist; durch die menschliche Berührung bestimmter Fleischstücke werden diese im Ritus profaniert und für jedermann essbar. Der moderne Kannibale – so kann man Agambens Gedankengang weiterführen – nimmt sich von Anfang an das Recht auf das ganze Opfer, das somit nicht länger ein Opfer im religiösen Sinne sein kann und doch noch auf dieses zurückverweist. Auch die zweite, zentrale Wirkung, die Agamben in der Profanierung ausmacht, wird vom aufgeklärten Kannibalen auf perverse Weise erfüllt: Er überführt sein Objekt aus Strukturen strikter, ritueller Reglementierung ins menschliche Spiel. Spielerisch in diesem Sinne ist nicht nur Penthesileas Wortspiel, das aus Bissen Küssen macht, oder das tödliche Liebesspiel in Liebesopfer, spielerisch ist auch das Schlachten Minskis, Batemans und Lecters, das den unmittelbaren Genuss einem ökonomischen Nutzen vorzieht.
Während für Agamben der Spiel-Charakter der Profanierung einen Ausweg kennzeichnet, die Macht rigider Systeme zu brechen, erweist er sich im Angesicht des Kannibalen als hochproblematisch. Der spielerische und doch todernste Biss ins Menschenfleisch bedeutet zwar eine Befreiung aus der Sphäre metaphysischer gesellschaftlicher Setzungen und eine Selbstbehauptung menschlicher Freiheit. Doch diese spielerische Freiheit genügt dem aufklärerischen Auftrag Agambens ebensowenig wie die kannibalische Drastik demjenigen Dietmar Daths. Im kannibalischen Spiel erfüllt sich hingegen sehr wohl Agambens Behauptung, dass die Profanierung, „eine Neutralisierung dessen [beinhaltet], was sie profaniert.“[46] Profaniert ist der menschliche Körper etwas Neutrales, ein Zeichen jenseits von symbolischen Dimensionen, das im Spiel neue Zwecke erhält – und sei es nur die Befriedigung eines perversen Appetits.
Armin Meiwes Tat hat mit Rollenspielen begonnen und vielleicht kann man sagen, dass er auch im Moment der Tat nicht aufgehört hat, ein Spiel zu spielen, dessen Grenzen nur durch die eigene Imagination und den Kontrakt mit seinem Opfer, nicht aber durch gesellschaftliche Restriktionen gesetzt wurden. Es mag darum auch wenig erstaunen, dass Meiwes während des Prozesses seine Tat mit der heiligen Kommunion verglich, die er in seinem tödlichen Spiel profaniert hat.
Wenn sich mithilfe fiktionaler Kannibalen etwas über Meiwes’ Tat herausfinden lässt, dann kann diese Erkenntnis nicht die genauen Umstände dieses Vergehens betreffen – die zu rekonstruieren war Aufgabe der Gerichte –, sondern die Bedeutung, welche sie für eine Gesellschaft und ihr Selbstverständnis hat. Die rationale Rechtfertigung des Kannibalismus, die sich in ethischen, ästhetischen und letztlich epistemischen Kontrakten äußert, verunsichert nicht, weil sie unseren aufklärerischen Ideen zuwiderläuft oder weil sie diese auf grausame Weise erfüllen könnte. Apologien des Menschenfressers treiben die Aufklärung an einen Punkt, an dem sie sich selbst auf die Probe stellt, an dem ihre Grundsätze als Widersprüche zugespitzt sind. Der vernünftige Kannibale verleibt sich Aufklärung ein und transformiert sie auf eine historische Lage reagierend, in der ihre Ideale in hohem Maße prekär werden. Nur ein unansehnlicher Teil dieser gefährdeten Aufklärung wird von ihm als scheinbar Unaufgeklärtes ausgeschieden, das Wesentliche wird zum Kannibalen selbst. Oder umgekehrt: Der Kannibale wird, als dessen Produkt und Produzent zugleich, zum Teil einer prekären Aufklärung über diese und uns alle.
Ich danke Hendrik Blumentrath, Joseph Vogl, Jörg Klenk und Annekathrin Kohout für versierte Korrekturen und anregende Kommentare zu diesem Text.
Elias Zimmermann arbeitet derzeit an seinem Post-Doc-Projekt „Apologien des Menschenfressers. Kulturwissenschaftliche Lektüren zu einem Gegendiskurs der Neuzeit“ am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin.
Anmerkungen
[1] Die Frage nach Armin Meiwes Rechtfertigung im Lichte der aufgeklärten Vernunft Immanuel Kants verdanke ich Wedel, Armin: Kant und der Kannibale. In: krisis. Kritik der Warengesellschaft. Online: http://www.krisis.org/2004/kant-und-der-kannibale/ (abgerufen am 20.10.17).
[2] Dath, Dietmar: Die salzweißen Augen. Vierzehn Briefe über Drastik und Deutlichkeit. Frankfurt a. M. 2005. S. 168.
[3] Ebd., S. 167.
[4] Vgl. Pöhl, Friedrich: Kannibalismus – eine anthropologische Konstante? [Einleitung]. In: Kannibalismus, eine anthropologische Konstante? Hrsg. v. Friedrich Pöhl/Sebastian Fink. Wiesbaden 2015. S. 9-49.
[5] Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt a. M. 2009. S. 75.
[6] Herder, Johann Gottfried: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Bd. 1/2. Hrsg. v. Heinz Stolpe. Berlin/Weimar 1965. S. 156.
[7] Vgl. Avramescu, Cătălin: An Intellectual History of Cannibalism. Übers. v. Alistair Ian Blyth. Princeton/Oxford 2011. S. 2.
[8] Kleist, Heinrich von: Penthesilea. Ein Trauerspiel. In: Ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe. Bd. 1/5. Hrsg. v. Roland Reuß/Peter Staengele. Basel/Frankfurt a. M. 1988. V. 2998.
[9] Vgl. Voltaire: Anthropophages. In: Ders.: Dictionnaire philosophique. Les Œuvres complètes Voltaire, Bd. 35. Hrsg. v. Ulla Kölving u.a. Oxford 1994. S. 344-350. Hier: S. 344.
[10] Kleist: Penthesilea, V. 2999.
[11] Kleist: Penthesilea, V. 3027.
[12] Sade, Donatien-Alphonse-François de: Justine und Juliette. Bd. 7/10. Hrsg. v. Stefan Zweifel/ Michael Pfister. München 1996. S. 205.
[13] Sade, Donatien-Alphonse-François de: Justine und Juliette. Bd. 8/10. Hrsg. v. Stefan Zweifel/ Michael Pfister. München 1996. S. 33.
[14] Sloterdijk, Peter: Kritik der zynischen Vernunft. Bd. 1/2. Frankfurt a. M. 1983. S. 222.
[15] Vgl. Bischoff, Eva: Kannibale-Werden. Eine postkoloniale Geschichte deutscher Männlichkeit um 1900. Bielefeld 2011.
[16] Lessing, Theodor: Haarmann. Die Geschichte eines Werwolfs und andere Gerichtsreportagen. Hrsg. v. Rainer Marwedel. München 1995. S. 81.
[17] Vgl. Brown, Jennifer: Cannibalism in Literature and Film. New York NY 2012. S. 40.
[18] Vgl. Moser, Christian: Kannibalische Katharsis. Literarische und filmische Inszenierungen der Anthropophagie von James Cook bis Bret Easton Ellis. Bielefeld 2005. S. 81f.
[19] Heye, Arthur: Hatako. Das Leben eines Kannibalen. Berlin 1927. S. 292. Dazu Fulda, Daniel: „Versteckter Appetit nach Menschenfleisch“. Faszination und Funktion kannibalistischer Figuren bei Thomas Mann und in der Weimarer Republik. In: Das Andere Essen. Kannibalismus als Motiv und Metapher in der Literatur. Hrsg. v. Daniel Fulda/ Walter Pape. Freiburg i. B. 2001. S. 259-300. Hier: S. 291.
[20] Vgl. ebd., S. 259f. Bei Mann ist der dionysische Kannibalismus jedoch keinesfalls nur positiv besetzt, wie etwa der Traum des Sonnenvolkes im Zauberberg zeigt (vgl. ebd., S. 263-267).
[21] Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. Bd. 1 u. 2. Hrsg. v. Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg 2001. S. 1020.
[22] Jünger, Ernst: Violette Endiven. In: Ders.: Das abenteuerliche Herz. Figuren und Capriccios. 2. Fassung. Hamburg 1938. S. 11f. Hier: S. 12.
[23] Vgl. Bohrer, Karl Heinz: Die Ästhetik des Schreckens. Die pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk. München u.a. 1978. S. 250.
[24] Benjamin, Walter: Karl Kraus. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd 2.1/7. Hrsg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M. 2003. S. 334-367. Hier: S. 355.
[25] Kraus, Karl: Die Fackel 39 (1934). S. 160. Vgl. Rickels, Laurence A.: Aristokritik. In: Das Andere Essen. Kannibalismus als Motiv und Metapher in der Literatur. Hrsg. v. Daniel Fulda/ Walter Pape. Freiburg im Breisgau 2001. S. 369-392. Hier: S. 383.
[26] Tabori, George: Die Kannibalen. Übers. v. Peter Sandberg. In: George Tabori: Theater. Bd. 1/2. Hrsg. v. Maria Sommer/Jan Strümpel. Göttingen 2014. S. 237–299. Hier: S. 244.
[27] Ebd., S. 284.
[28] Ellis, Bret Easton: American Psycho. New York 2006. S. 345.
[29] Micheal Rymer (Regie): Hannibal (TV-Serie), Staffel 2, Folge 12 („Tome-wan“). Produziert v. Brian Fuller. Erstausstrahlung: 16.5.2014 auf NBC.
[30] Vgl. Moser: Kannibalische Katharsis, S. 111.
[31] Collins, Michael: Meme Resonance with Hannibal Lecter. In: Daily Stormer. Internet: https://dstormer6em3i4km.onion.link/meme-resonance-with-hannibal-lecter/ (Abgerufen am 15.2.2018).
[32] Mora, Terézia: Über die Drastik. In: BELLA triste 16 (2006). S. 68-74. Hier S. 74.
[33] Vgl. dazu Linck, Dirck: Über die Möglichkeiten des popkulturellen Vergnügens an drastischen Gegenständen. In: Grenzen der Katharsis in den modernen Künsten. Transformationen des aristotelischen Modells seit Bernays, Nietzsche und Freud. Hrsg. v. Martin Vöhler/Dirck Linck. Berlin/New York 2009. S. 293-322. Mosers kritisches Argument, dass moderne Kannibalen wie Lecter eine problematische Katharsis durch Kannibalismus vermitteln, ist gerade auch unter diesem Gesichtspunkt zurückzuweisen: Es muss unterschieden werden zwischen moralischen Rechtfertigung, die tatsächlich eine kannibalische ‚Reinigung’ von Gesellschaft und Individuum skizziert, und ästhetischer Wirkung, die selbst einer weit ambivalenteren Drastik zuzuordnen ist.
[34] So das 42. Athenäeums-Fragment: „Gute Dramen müssen drastisch sein.“ Schlegel, August Wilhelm und Schlegel, Friedrich (Hrsg.): Athenaeum. Eine Zeitschrift. Bd. 1/2. Berlin 1798. S. 189. Vgl. hierzu auch Giuriato, Davide: Aktualität des Drastischen. Zur Einleitung. In: Drastik: Ästhetik – Genealogien – Gegenwartskultur. Hrsg. v. Davide Giuriato/Eckhard Schumacher. Paderborn 2016. S. 7-19. Hier: S. 13.
[35] Franz Kafka: Briefe 1902-1924. Frankfurt a. M. 1998. S. 28.
[36] Ebd., S. 27.
[37] Ebd.
[38] Neumann, Gerhard: Hungerkünstler und Menschenfresser. Zum Verhältnis von Kunst und kulturellem Ritual im Werk Franz Kafkas. In: Archiv für Kulturgeschichte 66, H. 2 (1984). S. 347-388. Hier: S. 375.
[39] Ebd., S. 387.
[40] Drakulic, Slavenka: Das Liebesopfer. Aus dem Kroatisch übers. v. Astrid Philippsen. Berlin 2000. S. 59.
[41] Ebd., S. 200.
[42] Ebd., S. 32.
[43] Ebd., S. 33.
[44] Dutli, Ralph: Der Hunger einer frommen Katholikin. In: FAZ (14.10.1997). (Online verfügbar: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-der-hunger-einer-frommen-katholikin-11301076-p2.html).
[45] Vgl. Drakulic: Das Liebesopfer, S. 191. Ausdrücklich wird dort auf einen Flugzeugabsturz und den darauf folgenden Hungerkannibalismus in den Anden von 1972 hingewiesen. Der Überlebende Roberto Canessa rechtfertigte sein Handeln, indem er es mit der heiligen Kommunion verglich. Vgl. Read, Piers Paul: Alive. The Story of the Andes Survivors. New York NY 1974. S. 83.
[46] Agamben, Giorgio: Lob der Profanierung. In: Ders.: Profanierungen. Frankfurt a. M. 2005. S. 79-91. Hier: S. 74.




