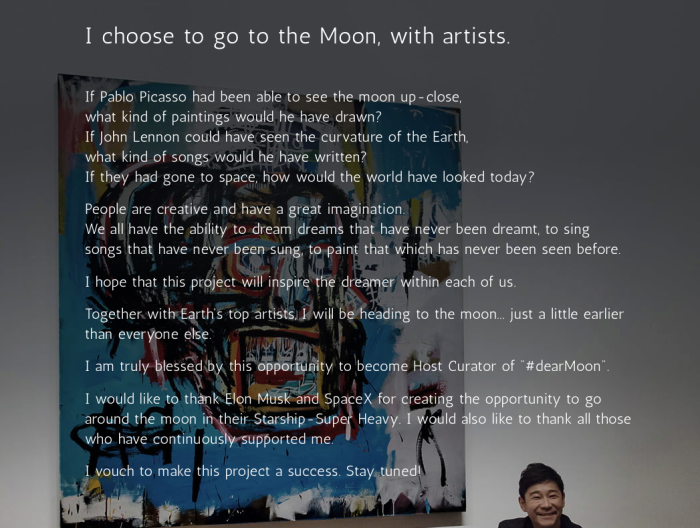Im Sog des globalisierten Kunstmarkts
Danach gefragt, wie sich das Verhalten von Kunstsammlern im Zuge der Globalisierung des Kunstmarkts verändert habe, gab Loïc Gouzer, der in den letzten Jahren einige der wichtigsten Auktionen für Christie’s organisierte (dazu später mehr), eine bemerkenswerte Antwort. So hob er – in einem Interview im Juni 2018 – hervor, wie sehr die Geschwindigkeit zugenommen habe, mit der die Kunstgeschichte nachvollzogen werde. Dabei erwähnte er speziell chinesische Sammler. Hier der Wortlaut der Passage: „Herkömmlich würde man einem Sammler empfehlen, zuerst einen Renoir oder einen Chagall zu kaufen, und dann bräuchte er fünfzig Jahre, bis er so weit wäre, einen Robert Ryman zu kaufen. Chinesische Sammler kaufen vielleicht zuerst einen Renoir, um in den Kunstmarkt einzusteigen, und nur sechs Monate später kaufen sie schon ihren ersten Ryman oder Bruce Nauman.“ (“Traditionally, you would say to the collector, “Start buying Renoir first, or Chagall,” and then it would take him 50 years to get to buying a Robert Ryman. The Chinese maybe buy a Renoir first as an entry point to the art market, and in six months they’re already buying their first Ryman or Bruce Nauman.”)[1]
Gouzers Formulierung legt die Vorstellung nahe, jeder einzelne Sammler habe der Entwicklung der Kunstgeschichte genau zu folgen. Damit überträgt er eine Denkfigur, die zuerst in der Evolutionsbiologie – namentlich bei Ernst Haeckel – Verbreitung fand, auf den Kunstbetrieb. Glauben manche, dass die Ontogenese – die Entwicklung eines einzelnen Organismus – die Phylogenese – die Entwicklung der gesamten Art – zu rekapitulieren hat, so soll also auch eine Kunstsammlung in ihrer Genese die Geschichte der Kunst wiederholen. Diese Idee mutet schon allein deshalb seltsam an, weil sie unterstellt, ‚die’ Geschichte der Kunst sei weniger eine Sache von Interpretation als eine Abfolge objektiver kausaler Prozesse. Und müssten Sammler diese Abfolge wirklich immer selbst noch einmal nachvollziehen, hätten alle privaten Kunstsammlungen – anders als es faktisch zu beobachten ist – ganz ähnlich zu entstehen und auszusehen. Schließlich liefe diese Idee darauf hinaus, einzelne Künstler oder Kunstwerke wie einzelne Arten zu betrachten, die jeweils eine genaue Stellung im Stammbaum der Kunst einnehmen. Ein Ryman hinge dann mit einem Renoir vielleicht ungefähr so zusammen wie ein Stachelschwein mit einem Hasen.
Doch vielleicht meint Gouzer es nicht so streng, wie es klingt, und man sollte die betreffende Interview-Stelle einfach nur als Ausdruck seiner Überzeugung interpretieren, eine seriöse Sammlung ergebe sich immer aus einem fundierten Verständnis von Kunstgeschichte. Chinesische Sammler würde er dann dafür bewundern, dass sie kunsthistorische Abläufe so schnell kapieren, während sich Sammler früher – in den letzten Jahrzehnten – offenbar noch viel schwerer damit taten, den Weg von Renoir zu Ryman zu gehen. Mochte das daran liegen, dass sie, im Unterschied zu heute, kaum historische Distanz zur Entwicklung der modernen Kunst hatten, so hatten sie andererseits eigentlich einen Startvorteil, da sie ja derselben westlichen Kultur angehörten, deren Kunst sie kauften. Umso erstaunlicher ist es also, dass Chinesen, die sich, wie etwa auch Inder oder Araber, erst in den letzten Jahren verstärkt auf den Kunstmarkt begeben haben, so mühelos mit der westlichen Kunstgeschichte zurechtkommen.
Dass gerade sie so rasch von Renoir zu Ryman gelangen, könnte aber auch Indiz für eine ganz andere Situation sein. Vielleicht nämlich sind chinesische – oder andere nicht-westliche – Sammler nicht deshalb so schnell, weil sie die Geschichte der Kunst so gut rekapitulieren können, sondern weil sie daran – im Gegenteil – gar kein Interesse mehr haben. Vielleicht verdankt sich die Abfolge ihrer Erwerbungen somit keineswegs einem kontinuierlich und zügig wachsenden historischen Wissen. Vielleicht könnten sie sogar genauso zuerst einen Ryman und dann einen Renoir kaufen. Vielleicht haben sie also ganz andere Kriterien, nach denen sie entscheiden, was sie in ihren Sammlungen haben wollen. Vielleicht ist der westliche Kunstbegriff für sie irrelevant.
Gouzer selbst enthält sich des Verdachts, Sammler – zumal aus nicht-westlichen Kulturen – würden Kunstwerke immer weniger als Teil einer Kunstgeschichte betrachten, obwohl er im selben Interview weitere Aussagen trifft, die ebenfalls als Indizien einer solchen Entwicklung gewertet werden können – und mit denen er viele seiner Kunden auch gar nicht mehr so positiv charakterisiert. So spricht er darüber, dass er mit Sammlern noch vor zehn Jahren lange Gespräche über einzelne Werke geführt habe, in denen der Catalogue Raisonnédes jeweiligen Künstlers eine große Rolle gespielt habe: Man diskutierte über die Stellung des jeweiligen Werks innerhalb des Gesamtwerks und damit innerhalb der Geschichte des Künstlers sowie über dessen Stellung innerhalb der gesamten Kunstgeschichte. Mittlerweile hingegen wollten viele Sammler nur noch wissen, ob es sich bei einem Werk, das zur Versteigerung anstehe, um A-Ware, A+-Ware oder B+-Ware handle. Und ohne sich vorab länger damit zu beschäftigen, würden Sammler selbst zwanzig oder dreißig Millionen Dollar für ein Werk ausgeben; oft hätten sie nur eine Abbildung davon auf Instagram gesehen – und ihm, dem Experten, keine weiteren Fragen dazu gestellt. Überhaupt würden nur noch 8% der Sammler – keine Ahnung, wie Gouzer auf diese Zahl kommt – über Kunst diskutieren („only eight percent of the collectors today actually enjoy discussing art and asking questions“). Ihn selbst stimme das traurig („sometimes I get a bit depressed about it“), denn er und seine Kollegen könnten den Sammlern so viel Wissen mitgeben, das sie im Lauf der Jahre erworben hätten. Nostalgisch blickt er also auf die Zeiten zurück, als es nicht nur Verkäufe, sondern auch Verkaufsgespräche gegeben hat.
Das klingt ziemlich kulturpessimistisch, so als hätten Neureiche den Markt erobert, ohne Ahnung von dem, was sie wirklich kaufen. Doch ist Gouzer damit nicht unfair? Sollte es wirklich so sein, dass die Sammler die guten alten Kriterien, wonach sich die Bedeutung eines Werks vor allem anderen aus seiner Stellung innerhalb der Kunstgeschichte ergab, vergessen oder gar leichtsinnig über Bord geworfen haben, ohne zugleich neue Kriterien zu etablieren? Oder haben sie zwar neue Kriterien, doch sind diese ihrerseits so oberflächlich, dass sie der Kunst überhaupt nicht gerecht werden? Tatsächlich legt Gouzer das nahe, zumindest in folgenden zwei Sätzen desselben Interviews: „Was jedoch nicht gerade gesund ist, ist die Tatsache, dass [auf dem Kunstmarkt] wie überall sonst die Macht der Marken unermesslich groß wird. Die Leute kaufen in Galerien oder Auktionshäusern, als handle es sich dabei um Hermès oder Gucci oder Tom Ford.“ („What is not very healthy, however, is the fact that—as is the case everywhere—the power of brands is becoming overwhelming. So people buy from galleries and auction houses as if they were Hermès or Gucci or Tom Ford.”)
Gut gebrüllt, Löwe – möchte man Gouzer zurufen, doch nimmt man diese Worte auch sogleich wieder zurück, wenn man ein wenig genauer darauf schaut, was der Auktionator in den letzten Jahren gemacht hat. Dann nämlich kommt man nicht um die Diagnose herum, dass Gouzer etwas beklagt, das er selbst wesentlich mit verursacht hat. Dass kunsthistorische Kriterien und Betrachtungsweisen im Kunstbetrieb zunehmend an Bedeutung verlieren, ist nicht zuletzt Folge einer neuen, von ihm durchgesetzten Auktionspolitik. Wegen ihr wurde er berühmt, und sie hat sogar einen eigenen Namen erhalten. So gilt Gouzer als Erfinder, zumindest aber als Meister der ‚kuratierten Auktion’.[2] Dabei hat er Methoden, die Kuratorinnen und Kuratoren bei Ausstellungen schon länger anwenden, auf das Auktionswesen übertragen und damit bei Christie’s einige spektakuläre Erfolge erzielt. Die von ihm adaptierten kuratorischen Methoden bestehen aber gerade darin, Kunstwerke nicht nach Gesichtspunkten der Kunstgeschichte aufeinander zu beziehen, sondern sie nach Themen anzuordnen oder aufgrund eines interessanten Zusammenspiels von Ähnlichkeiten und Unterschieden zu kombinieren.
In Museen und bei Ausstellungen ist das bereits in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts zu einer üblichen Praxis geworden. In aller Kürze ein paar Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum: 2001 beauftragte Jean-Hubert Martin, Direktor des Städtischen Kunstmuseums Düsseldorf, die beiden Künstler Thomas Huber und Bogomor Ecker, die Bestände des Hauses unabhängig von einer chronologischen oder gattungsbezogenen Ordnung zu arrangieren. Er begründete das Experiment damit, dass eine „rein kognitiv argumentierende“, nämlich eine historisch denkende Kunstgeschichte „durch eine neue Form visueller Argumentation ersetzt oder ergänzt werden“ müsse, „durch ein Denken in Bildern und Bildkombinationen“. Mithilfe der Künstlerkuratoren könne es gelingen, „die ‚klassischen Werke‘ neu [zu] interpretieren“.[3] Und Bogomir Ecker sekundierte, indem er an die Museen appellierte, sie sollten die „Ghettoisierung in Epochenunterteilungen“ aufgeben und dafür die Fähigkeit üben, „Bildzusammenhänge und Dialoge zu erstellen“.[4]
2010 eröffnete der Sammler Thomas Olbricht in Berlin Räume, in denen er jeweils Teile seiner Sammlung mit Werken aus der Zeit zwischen dem 16. Jahrhundert und der Gegenwart ausstellt, wobei die „genre- und epochenübergreifende Auswahl“ darauf angelegt sei, so heißt es auf der Website zur Sammlung, „Überraschungen und Widersprüche“ hervorzuheben. Und weiter: „Das entscheidende Sammlerkriterium ist, ob eine Arbeit ins Staunen versetzen und zu einem neuen Blick auf die Welt verhelfen kann.“[5] In einem der Räume ist sogar eine ‚Wunderkammer’ eingerichtet – und damit ein vormoderner Typus von Sammlung wiederbelebt, bei dem Artefakte und Naturalien ebenfalls nicht nach historischen, sondern vielmehr nach systematisch-ontologischen Kriterien ausgewählt und angeordnet sind – und wo zugleich „außergewöhnliche Kunst- und Naturobjekte“ einander gleichgestellt werden.[6]
Ebenfalls 2010 kombinierte man in der Hamburger Kunsthalle Werke der eigenen Sammlung in „ungewohnten Nachbarschaften“, legte also etwa vor Caspar David Friedrichs „Eismeer“ einen Steinkreis von Richard Long. Der von einer Leuchtschriftarbeit von Maurizio Nannucci übernommene Titel der Ausstellung „All Art has been Contemporary“ signalisiert programmatisch die Abkehr von kunsthistorischem Denken. Statt die Werke als Dokumente verschiedener Epochen zu würdigen, sollen sie alle so zeitgenössisch zur Geltung kommen, wie sie es einmal waren. Erklärtes Ziel der Ausstellung waren auch hier „neue vergleichende Seherlebnisse“.[7]
In allen Fällen verspricht man sich von einer diachronen Anordnung also Auffrischung und Überraschung, die Befreiung aus eingefahrenen – sprich: kunsthistorisch geprägten – Sichtweisen. Es scheint, als sei man einer Wahrnehmung der Kunst nach Epochen überdrüssig geworden, erhoffe sich von etwas Abwechslung aber nicht nur Unterhaltung (delectare), sondern auch neue Einsichten (prodesse). Die Werke sollen dadurch – wieder – präsenter werden und vitaler erscheinen. Thomas Huber sprach bezogen auf das Düsseldorfer Projekt davon, dass ein Werk, das „in neue Zusammenhänge gestellt“ werde, „auch seine Bedeutung ändert“.[8] Er reagierte damit auf einen Protestbrief der Fachgruppe kulturhistorischer Museen und Kunstmuseen im Deutschen Museumsbund, in dem davor gewarnt wurde, „Kunstmuseen durch die Originalität von Künstlern interessanter und überraschender zu machen“. Vielmehr müsse „das moderne Museum […] seine innere Ordnung und seine Qualitätsentscheidungen wissenschaftlich – das heißt durchschaubar und kritisierbar – begründen“.[9] Werke sollen nach objektiven Kriterien wie ihrer zeitlichen oder örtlichen Entstehung präsentiert, keinesfalls hingegen infolge individueller Assoziationen angeordnet werden.
War die kuratorische Methode des diachronen Hängens anfangs also noch aufgrund der ihr unterstellten Willkürlichkeit umstritten, so wurde in der Folgezeit ein anderer Vorwurf laut. Denn sofern Werke je nach Zusammenhang mit anderen, neuen, zusätzlichen Bedeutung zur Geltung kommen, weckt das auch spekulative Phantasien – und es reizt, auszuprobieren, welche semantischen Potenziale noch genutzt werden könnten. Dann geht es aber vielleicht nicht mehr nur um neue Erkenntnisse, sondern auch um neue Vermarktungsmöglichkeiten. Aus der Bedeutungsschöpfung wird eine Wertschöpfung. Das wurde etwa 2011/12 kritisiert, als das Stockholmer Moderna Museet sowie die Staatsgalerie Stuttgart die Ausstellung „Turner – Monet – Twombly. Later Paintings“ zeigten. Einige unterstellten, durch die Kombination mit zwei unumstrittenen Größen solle der kurz zuvor verstorbene Twombly aufgewertet werden; die Museen dienten dem mit Twombly auch kommerziell verbundenen Kurator dazu, dessen noch auf dem Markt verfügbaren Werken eine „geldwerte Nobilitierung“ zukommen zu lassen.[10]
Dass auch Auktionshäuser auf die Idee kamen, ihre angestammten Formate zu verändern, braucht daher nicht zu verwundern. So engagierte Philippe de Pury 2010 den Kurator und Händler Philippe Segalot für eine Auktion moderner Kunst unter dem Titel “Carte Blanche“, die sich jedoch noch kaum durch ungewöhnliche – diachrone – Kombinationen und Abfolgen auszeichnete; vielmehr bestand die kuratorische Leistung darin, die Ausstellung, in der die Werke vor der eigentlichen Versteigerung Kaufinteressenten präsentiert werden, nach denselben – hohen – Ansprüchen anzulegen, die bis dahin nur von Museen oder Ausstellungshäusern geboten wurden.
Erst Loïc Gouzer ging so weit, Kuratoren auch darin nachzueifern, auf überraschende Kombinationen jenseits kunsthistorischer Logik zu setzen. Wie Thomas Huber folgt er dabei der Überzeugung, dass jeder neue Zusammenhang einem Werk eine andere Bedeutung verleihe (“If you start putting works around another work, they give each other meaning”), sich die Werke also, bringt man sie in einen Dialog miteinander, „gegenseitig helfen“ (“Each of the works are in dialogue, and they help each other.”).[11] An anderer Stelle spricht er sogar davon, Werke, die man zusammenbringe, obwohl es eigentlich keine zwingenden Gründe dafür gebe, könnten sich „wechselseitig aktivieren“, so dass erstmals offenbar wird, was in ihnen steckt. („I love the power of juxtaposing works that are not necessarily meant to be together, because they activate each other.”)[12]
Am berühmtesten wurde Gouzers 2015 organisierte Auktion „Looking Forward to the Past“ – auch das ein programmatischer Titel, da, ähnlich wie bei „All Art has been Contemporary“, dem Vergangenen eine neue Zukunft zugesprochen und Sammlern und Anlegern suggeriert wird, die Kunst, die man ihnen zum Kauf anbiete, habe noch viel vor sich, egal von wann genau sie stamme. Einen Claude Monet, der in einer Auktion mit Kunst des 19. Jahrhunderts oder des Impressionismus kaum für großes Aufsehen gesorgt hätte, brachte Gouzer mit Mark Rothko und Alberto Giacometti zusammen. Ebenso gab es Egon Schiele in Verbindung mit Elisabeth Peyton oder Piet Mondrian in Assoziation mit On Kawara – dies alles Kombinationen, die bis dahin bei Auktionen mit meist eng umrissenen Objekttypen nicht denkbar gewesen wären.
Dass mit 34 Losen mehr als 700 Millionen US-Dollar ersteigert wurden und „Looking Forward to the Past“ damit zu den erfolgreichsten Auktionen aller Zeiten gehört, ist zwar sicher nur teilweise der überraschenden – spekulative Energien stimulierenden – Kuratierung der Werke zu verdanken, ermutigte Gouzer und seinen Arbeitgeber Christie’s aber dazu, noch mehr auszuprobieren. Im November 2017 brachten sie das Leonardo da Vinci zugeschriebene Gemälde „Salvator Mundi“, entstanden um 1500, bei einer Auktion für „Post-War and Contemporary Art“ in New York unter den Hammer. Kuratiert wurde es zusammen mit einer Version von Andy Warhols Paraphrasen auf Leonardos „Letztes Abendmahl“, versteigert zudem im Umfeld von Mark Rothko, Louise Bourgeois und Jean-Michel Basquiat.

Das Los sorgte mit über 450 Millionen US-Dollar für einen Weltrekord – und danach für diverse Mutmaßungen über den Käufer. (Nach neuestem Stand erhielt ein Unterhändler des arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman – derselbe, der ein knappes Jahr später den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi befohlen haben soll – den Zuschlag. Doch dass er als Moslem gerade ein Christusbild erworben hatte, fand man in seiner Familie offenbar nicht gut, daher tauschte er das Bild gegen eine Yacht mit Mohammed bin Zayed aus Abu Dhabi, ebenfalls ein Kronprinz, der bei der Auktion selbst noch unterlegen war.[13])
Dass der Leonardo nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, unter „Old Masters“ versteigert wurde, wozu es zwei Wochen zuvor eine passende Gelegenheit gegeben hätte, Gouzer ihn vielmehr dank des ungewohnten, um rund 500 Jahre verschobenen zeitlichen Kontexts verfremdete, geradezu zu einem surrealen Artefakt machte, stellt den bisher stärksten Bruch mit kunsthistorischen Gepflogenheiten dar. Umso unglaubwürdiger erscheinen daher auch seine Klagen darüber, dass viele heutige Sammler sich nicht mehr für Gesamtwerke und Gespräche kunstgeschichtlichen Charakters interessieren, sondern Kunstwerke und Künstler wie Marken behandeln.
Und wie soll man es einschätzen, dass Gouzer für den Werbefilm einer anderen Auktion, die er 2014 unter dem – aus einem Gemälde von Richard Prince bezogenen – Titel „If I Live I’ll See You Tuesday…“ organisierte, sogar den bekannten Skateboarder Chris Martin verpflichtete?
Vier Minuten lang ist er in waghalsiger Fahrt durch die Räumlichkeiten und Etagen des Auktionshauses zu sehen, jeweils knapp an einzelnen Losen der Auktion vorbeirasend. Zwischendurch flirtet er mit einer Angestellten, die sich im Keller gerade um ein pornografisches Gemälde von John Currin kümmert, macht High-Five mit einem ‚art handler’ – und stürzt schließlich beim Versuch, einen Transportwagen zu überspringen, mit dem ein Kippenberger-Gemälde in seiner Transportkiste vor eine Ausstellungswand gefahren wurde. Statt einen Kunsthistoriker oder zumindest einen bekannten Sammler für die Werke sprechen zu lassen, wird also der Vertreter einer Sportart zum Testimonial, die so gut wie keiner selbst der jüngeren Milliardäre und Multimillionäre betreiben könnte, die sich für die Werke der Auktion interessieren. Dafür erscheint Kunst umso mehr als cooles Hobby für Jungens (nur zwei der 33 versteigerten Werke der Auktion stammten von Frauen, von Cady Noland und von Rebecca Quaytman), als etwas zum Angeben und Repräsentieren, als Summe ebenso exklusiver wie global bekannter Top-Marken. Wer es nicht (mehr) schafft, mit sportlichen Leistungen zu imponieren, hat mit moderner Kunst immer noch – oder erst recht – gute Chancen. Das ist die Botschaft des Werbefilms, der damit seinerseits alles tut, um Kunst ganz weit weg von Kennerschaft und historischer Bildung und ganz nah an einem markenbewussten Luxus-Lifestyle anzusiedeln.
Ist es also nicht einfach nur unehrlich, wenn Gouzer einerseits den seriösen Kunsthistoriker mimt, der fachkundige Sammler als Gegenüber vermisst, andererseits jedoch mit seiner Arbeit als Auktionator gerade diejenigen umwirbt, bei denen kein spezifisch kunstgeschichtliches Interesse vorliegt? Vielleicht liegt hier tatsächlich ein Fall von Doppelmoral vor, vielleicht ist aber auch eine andere, weiterreichende Diagnose möglich.
Loïc Gouzer, 1980 in Genf geboren, aufgewachsen in der Schweiz, ging, nachdem er bereits einige Erfahrungen auf Reisen und mit Kunst und ihrem Markt gesammelt hatte, 2001zum Studium der Kunstgeschichte an das University College nach London. Dort aber erwartete ihn ein intellektuelles Klima, das überwiegend von postmodernen, antiessentialistischen Diskursen geprägt war; er traf auf Professorinnen wie Tamar Garb oder Briony Fer, die vor allem mit Schriften zu Gender-Theorie, Feminismus und ‚postcolonial studies’ bekannt geworden sind. Gouzer wurde akademisch also mit der Dekonstruktion westlicher Denkfiguren vertraut gemacht; er bekam mit, wie sehr insbesondere durch Singularbegriffe wie ‚Geschichte’, ‚Kunst’ und ‚Kanon’ Macht ausgeübt wird, ja wie beherrschend hierarchische, patriarchalische, exkludierende Strukturen sind – und wie sehr sie alles unterdrücken, was ihnen nicht entspricht. Im Gegenzug wurden Pluralisierung und Egalisierung propagiert, es ging darum, einen Sinn für Differenzen auszuprägen. An die Stelle der ‚einen’ westlichen Geschichte der Kunst sollten viele Erzählungen treten, die gerade auch das enthielten, was lange Zeit marginalisiert worden war, weil es von Minderheiten oder aus anderen Kulturen stammte.
Ausgehend von postmodernen Überzeugungen entwickelten viele Kuratorinnen und Kuratoren im weiteren Programme, mit denen denjenigen späte Gerechtigkeit widerfahren sollte, die vom weißen, männlichen, bildungsbürgerlich-autoritären Regime lange Zeit abgewertet oder gänzlich unsichtbar gemacht worden waren. Gewannen dabei nach und nach politisch-moralische Kriterien die Oberhand über rein kunsthistorische Erwägungen, so erklären sich zugleich auch die zahlreichen Versuche, mit chronologisch-starren Ordnungen in Museen zu brechen und alternative Formen der Sinnstiftung, ja freiere, nicht-kanonische Spielarten von Kombinatorik zu etablieren und damit die Kunstgeschichte hinter sich zu lassen, aus dem postmodernen Geist. Nachdem er schon ab den 1980er Jahren immer mehr Verbreitung gefunden hatte, war er spätestens zwanzig Jahre später in den Führungsebenen vieler Institutionen angelangt.
Die Idee kuratierter Auktionen verdankt sich ebenfalls den Denkfiguren der Postmoderne, auch wenn dafür kaum der Wunsch nach Wiedergutmachung oder die Kritik an Hierarchien ursächlich gewesen sein dürfte, bei ihnen also ebenso wenig wie bei bisherigen Auktionen unterdrückte Minderheiten entdeckt werden können. Vielmehr geht es bei dieser Idee um die Nutzung von Freiheiten, die bis dahin nicht existierten. Doch auch jenseits der von Wertschöpfungsphantasien stimulierten, geradezu alchemistischen Neugier, was wohl passiert, wenn man noch nie Kombiniertes kombiniert (Gouzer beschreibt Kunstwerke einmal als „Moleküle“, deren Verbindung zu sonst gar nicht möglichen Geschmackserlebnissen führe)[14], konnten kuratierte Auktionen gerade jetzt attraktiv und erfolgreich werden. Dass Gouzer mit ihnen kunsthistorische Parameter hinter sich lässt, fand nämlich nicht nur ein positives Echo bei vielen westlichen Kunden, die so postmodern sozialisiert sind wie er, sondern erst recht bei den Kunstkäufern anderer Regionen der Welt. Waren sie bisher oft abgeschreckt von der Vorstellung, sich erst dann auf dem Kunstmarkt behaupten zu können, wenn sie die Geschichte der Kunst kennen, ja empfanden sie sich infolge des westlich-hegemonialen Blicks auf die Kunst als dilettierende Außenseiter, gar als unerwünscht, so können sie nun ohne Defizitgefühle mitbieten. Bei einer kuratierten Auktion wird ihnen ein Werk nicht mehr offeriert, weil es für eine bestimmte Epoche bedeutsam ist oder weil es stilistisch oder ikonografisch prägend oder aber untypisch für seine Zeit war, sondern weil es von einem berühmten Künstler-Label stammt und nicht zuletzt wegen seines hohen Preises ein cooles, luxuriöses, weithin wiedererkennbares Statussymbol mit viel Distinktionskraft ist.
In einer Welt, in der es mittlerweile nicht nur im Westen, sondern genauso in Osteuropa, in Asien und in arabischen Ländern zunehmend mehr Reiche und Superreiche gibt, die ihre Geschäfte zudem fast alle international tätigen, vor allem aber ihr Geld global anlegen und ausgeben wollen, hätte dem Kunstmarkt nichts Besseres passieren können als ein Abschied von Normen, die zu sehr einer einzigen Kultur – der des Westens – entstammten. So selbstkritisch das postmoderne Denken gegenüber den Begriffen des Westens war und so sehr es dessen Machtansprüche relativieren wollte, so sehr hat es zu einer Stärkung des Kunstmarkts geführt, nachdem es in jemand wie Loïc Gouzer (wenn vielleicht auch nur in reduzierter Form) dort angekommen war. Mehr als anderes hat es ihn tauglich für die sich globalisierende Wirtschaft gemacht. Und umgekehrt wird dadurch, dass immer mehr Akteure nicht-westlicher Kulturen auf dem Kunstmarkt aktiv werden, die Erosion des westlichen Kunstbegriffs – von Begriffen wie ‚Geschichte’ und ‚Autonomie’ – weiter begünstigt und verstärkt. Intellektuelle und sozioökonomische Entwicklungen sorgen gemeinsam für einen Sog, in dem vieles verschwindet, was im Westen lange Zeit unumstößlich schien.
Doch wieso äußert sich Gouzer in jenem Interview dann so widersprüchlich? Wie kann gerade er das Schwinden kunsthistorischen Interesses bedauern und die Nase darüber rümpfen, dass Kunstwerke wie Markenprodukte gekauft werden? Die Antwort ist simpel: Vermutlich ist ihm seine eigene intellektuelle Sozialisierung gar nicht ganz bewusst. So nimmt er sich wohl als jemand wahr, der in einem durch und durch bürgerlichen Ambiente Kunstgeschichte studiert hat. Er dürfte auch ein wenig stolz auf seine überdurchschnittliche Bildung sein, und erst recht dürfte er jedes Mal, wenn er Werke verschiedener Jahrhunderte und Gattungen in einer kuratierten Auktion zusammenbringt, ein bisschen aufgeregt sein. Vermutlich spürt er nämlich noch die Frivolität einer solchen Konstellation jenseits kunsthistorischer Ordnung, kommt vielleicht sogar nur deshalb darauf, weil er diese Ordnung noch irgendwie im Kopf hat. Deshalb aber muss er es auch als Verlust ansehen, wenn er sich mit seinen Kunden nicht mehr über kunstgeschichtliche Fragen unterhalten kann. Und da er andere weiterhin nach Kategorien beurteilt, die von seinem eigenen historischen Wissen imprägniert sind, muss er es als große kognitive Leistung interpretieren, dass chinesische Sammler viel schneller eine schlüssige Kunstsammlung zusammentragen, als es Sammler aus dem Westen vermocht hätten.
Gouzer gehört also einer Generation an, die noch mit vielen der Begriffe, die durch postmodernes Denken dekonstruiert werden, aufgewachsen ist. Für ihre Vertreter bedeutet es immer sowohl eine gewisse Anstrengung als auch eine Befriedigung, die tradierten Konzepte zu überwinden. Erst im Lauf mehrerer Generationen ändert sich das; dann mag es zwar vielleicht immer noch ein Studienfach geben, das ‚Kunstgeschichte’ heißt, doch wird über Kunst dort dann in Begriffen gesprochen werden, die für Kuratoren relevant sind oder die Werke eher in sozioökonomischer als in stilistischer Hinsicht, eher hinsichtlich ihrer Funktionen als Luxusprodukte denn als Artefakte mit Autonomieanspruch analysieren.
Tatsächlich geht es um viel mehr als lediglich um die Preisgabe der Vorstellung von ‚der’ Geschichte ‚der’ Kunst – im doppelten Singular. Vielmehr dürfte damit zugleich der gesamte westliche Kunstbegriff der Moderne nicht mehr zu halten sein. Denn wie sollte man noch einen Begriff von Autonomie vertreten können, wenn man nicht eine starke Idee von Geschichte hat? Kunst, die Autonomie beanspruchte, musste sich nämlich immer über die Kunst definieren, die es bereits vor ihr gab. Sie musste sich auf Kunst und nicht auf anderes berufen, da sie sonst von diesem anderen bestimmt worden, also heteronom gewesen wäre, und sie musste sich zugleich von der vorangehenden Kunst absetzen, um möglichst selbständig – wirklich autonom – zu sein. Aus der Dialektik von Rückbezug und Distanzierung entwickelte sich in der Moderne eine erhebliche Dynamik; jede Richtung der Avantgarde wollte sich noch radikaler von allen anderen Richtungen absetzen und zugleich noch mehr, noch radikaler Kunst sein. Ein jeweils klares Bild von Fortschritt beherrschte die Künstler der Moderne, die Geschichte der Kunst war der verbindlich-notwendige Rahmen, der ihrem Tun Sinn und Ziel verlieh.
Wenn aber zwischen Leonardo und Warhol, zwischen Monet, Mondrian und Murakami keine kunstgeschichtlichen Entwicklungen mehr gesehen werden oder wenn diese für die jeweilige Beurteilung keine Rolle spielen, da alle Künstler als gleichermaßen zeitgenössisch gelten, die berühmt und von denen Werke zu kaufen sind, dann wird Kunst künftig unter ganz anderen Bedingungen entstehen. Ist Kunstautonomie erst einmal kein Anspruch mehr, braucht etwa auch nicht länger zwischen freier und angewandter oder zwischen hoher und niedriger Kunst unterschieden werden. Vielmehr zählt dann der Grad an Berühmtheit, der sich in Preisen, Quoten, Followern halbwegs messen lässt.
Etliche Ereignisse der letzten Jahre zeugen bereits davon, dass sich der globale Kunstbetrieb und gerade das avancierteste Segment des Kunstmarkts des westlich-modernen Kunstbegriffs insgesamt entledigt, wobei das, was hiesige postmoderne Bildungsbürger noch als Provokation – und entsprechend als interessanten Fall – empfinden mögen, Menschen anderer Kontinente als geradezu selbstverständlich erscheinen dürfte. Dass Sotheby’s 2017 in New York den Ferrari auktionierte, mit dem Michael Schumacher 2001 den Formel 1-Grand Prix in Monaco gewonnen hatte, dafür aber ebenfalls die Rubrik „Contemporary Art“, das Umfeld von Werken von Andy Warhol, Robert Indiana und Ed Ruscha wählte, war für alle, die einfach viel Geld für einmalige Luxusmarkenprodukte ausgeben wollen, eine gute und naheliegende Entscheidung. Immerhin hat man dann Verschiedenes aus derselben Preisliga auf einer einzigen Auktion versammelt. (Die 7,5 Millionen Dollar, die der Ferrari einbrachte, lagen letztlich sogar noch über den Preisen der meisten Kunstwerke der Auktion.) Idealerweise gäbe es dann zudem noch einen seltenen alten Wein, einen Möbel-Klassiker und eine spektakuläre Uhr im Angebot. Alles würde allem anderen noch mehr Bedeutung und Glamour verleihen, vor allem wären die Superreichen der Welt endlich ganz unter sich.
Wie ein Ferrari als Kunst versteigert wird, wird also umgekehrt – und erst recht – Kunst zunehmend wie ein Ferrari verkauft: wie (oder als) Luxusmarke – und nicht mehr als Kunst im westlich-modernen Sinne. Oder ist Warhol etwa nicht eine Marke mit einem ähnlich starken Image wie Ferrari? Warum also sollte man zwischen diesen beiden eher unterscheiden als zwischen Warhol und Koons oder zwischen Ferrari und Louis Vuitton? In allen Fällen geht es um Prominenz und Provenienz, um Starkult, vor allem aber um Geld und Konsum. Denn während die spirituelle, therapeutische, entgrenzende Kraft, die Kunstwerke in ihrer Autonomie verhießen, einem Rezipienten im Museum ebenso zugute kommen konnte wie einem Sammler, erfüllen Markenprodukte ihr Versprechen nur denjenigen, die sie besitzen. Nur wer sie kauft und Teil einer Markenwelt wird, kann etwas von deren Image auf sich übergehen lassen, kann so stark, so cool, so gewitzt erscheinen, wie es in der jeweiligen Marke angelegt ist. Ein Ferrari macht dann männlich, ein Warhol lässig-urban, ein Rothko anspruchsvoll-sensibel.
Hatten Kunstwerke bewundernde Rezipienten, die auf Erleuchtung hofften, haben Marken viel eher Fans. Diese suchen Nähe, vor allem physische Nähe zu ihren Idolen und allem, was von ihnen stammt. Das kann ein Autogramm oder ein Merchandising-Artikel sein, und der Besitz eines kleinen Stücks kann mehr bedeuten als die Beschäftigung mit einem Gesamtwerk. Um Nähe herzustellen, üben sich Fans zudem in Formen von Mimikry; sie versuchen, Teilhabe durch Adaption zu erreichen, zumal wenn es ihnen verwehrt bleibt, selbst etwas von der begehrten Marke zu konsumieren.
Die gesamte Bandbreite von Fan-Kult – im Unterschied zu Rezipienten-Verhalten – ließ sich gerade auch studieren, als Leonardos „Salvator Mundi“ in den Tagen vor der Auktion bei Christie’s in New York ausgestellt wurde. Das Auktionshaus selbst installierte eine Kamera neben dem Gemälde und veröffentlichte auf einem eigens eingerichteten Instagram-Account (@thelastdavinci) Fotos von Besuchern. Sieht man darauf durchwegs staunende, faszinierte Gesichter von Menschen, die die Nähe zum Original spüren wollen, so tauchen manchmal auch Adaptionsgesten auf.
Vor allem die segnende Hand des Weltenretters reizt zur Nachstellung. Für Fotos in den Sozialen Netzwerken platzierten sich viele Besucher sogar eigens in dieser Pose vor dem Gemälde – und verhielten sich damit eindeutig nicht wie Kunstrezipienten, sondern wie Fans, die ihrem Star nacheifern. Als Fan outete sich auch Takashi Murakami , der in den letzten zwei Jahrzehnten wie kaum ein anderer Künstler daran gearbeitet hat, sich selbst in eine Luxusmarke zu verwandeln (und von dem allein bei Christie’s bisher schon fast 800 Werke versteigert wurden).
Für ihn war der Besuch des Leonardo offenbar wie ein Termin mit einem anderen Promi, der dazu dient, beider Image weiter zu stärken. Zugleich konnte er es nicht unterlassen, der Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass ihm sein eigener Status ein Nähe-Privileg gegenüber anderen Fans einbringt. So dokumentierte er auf seinem Instagram-Account, garniert mit einem Dank an Loïc Gouzer, dass man ihn unter der Absperrung hindurchkriechen ließ, mit der „Salvator Mundi“ eigentlich vor dem Publikum geschützt werden sollte.
Im Gefolge des Hypes um den Auktions-Weltrekord kam es aber auch zu zahlreichen popkulturellen Persiflagen und Adaptionen des „Salvator Mundi“. Sämtliche seit Jahrzehnten entwickelten Bemühungen von Vermittlungsprogrammen, die darauf ausgerichtet sind, Kunst für ein breiteres Publikum zu öffnen, werden durch einen spektakulären Preis in den Schatten gestellt. Nun werden schlagartig Millionen erreicht, die, angezogen vom Glamour des Superteuren, einen Kontakt dazu suchen. Sie imaginieren, ihre eigene Lebenswelt könnte etwas damit zu tun haben, und dazu verniedlichen sie das Vorbild so lange, bis es halbwegs passt. Nicht zuletzt lässt sich so die eigene Begehrlichkeit – das Habenwollen – nochmals bekräftigen – ausleben und steigern –, denn je süßer und niedlicher etwas ist, desto stärker will man es knuddeln und an sich ziehen – ohne dabei Gefahr zu laufen, selbst von einer Übermacht erdrückt zu werden.
Fankultur hat also ein enges Verhältnis zu Formen des Niedlichen, und sobald Niedliches zum Teil der Konsumwelt wird, können daraus wiederum Marken werden. Dass es dabei zwischen einer massen- und popkulturellen Fan-Ästhetik und der Welt der Kunst – zwischen ‚high’ und ‚low’ – keine klaren Grenzen mehr gibt, ja dass die Differenz von beidem sogar völlig irrelevant wird, bestätigt, wie sehr der westlich-moderne Begriff von Kunst an Stellenwert verliert. Beispielhaft wurde das ein Jahr nach der Leonardo-Auktion sichtbar, als auf der Messe Art 021 in Shanghai ein neuer „Salvator Mundi“ zu sehen war.
Aus Jesus ist ein komisch-süßes Wesen mit großen Kulleraugen und Tierschnauze geworden, umgeben von da Vincis üppiger Haar- und Barttracht. Präsentiert wurde dieser ebenfalls mit Glaskugel ausgestattete „Salvator Mundi“ zusammen mit Security-Personal – in direkter Nachahmung der Art und Weise, wie Christie’s den Leonardo in Hong Kong gezeigt hatte. Schon vor der offiziellen Eröffnung der Messe wurde das Bild auch verkauft. Der Preis von 350.000 Dollar war zwar nicht einmal ein Tausendstel des Leonardo, dennoch dürfte er in den Augen vieler westlicher Kunstinteressierter sehr hoch gewesen sein, fällt es ihnen doch nach wie vor schwer, Kunst unabhängig von Hochkultur zu denken und genauso zu akzeptieren, wenn sie niedlich und nicht erhaben, smart und nicht schroff, süß und nicht rätselhaft ist.
Das kleine Gemälde – 66x48cm – war so teuer, weil sein Urheber einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Künstler ist. Es ist der US-Amerikaner Mark Ryden, Vertreter des Pop-Surrealismus, dem westliche Kritiker gerne das Attribut ‚lowbrow’ verleihen, so als wollten sie noch einmal markieren, dass sie das nicht wirklich als Kunst anerkennen können. So unbekannt Ryden deshalb in Europa ist, so berühmt ist er dafür in Asien, wo er zahllose Fans hat, die seine Motive populärer Bildwelten – aus Massenmedien, Konsum, Starkult – lieben. Und da sich die meisten nur Reproduktionen oder Merchandising-Artikel leisten können, gilt ein originaler, handgemalter Ryden umso mehr als Luxus. Auf einer Kunstmesse kauft man also nicht unbedingt Produkte, die sich ästhetisch vom Angebot in Läden mit Massenprodukten unterscheiden, sondern erweist sich nur als umso enthusiastischerer Fan, weil man viel mehr Geld als andere Fans ausgeben und damit stärker an einer Kultmarke teilhaben kann.
Wenn Kunstsammler Fans sind, die Kunstwerke wie andere Luxusprodukte empfinden und sich weder für Kunstgeschichte noch für die typischen Kategorien des westlich-modernen Kunstbegriffs interessieren, zeigt sich das auch an ihrem Umgang mit dem, was sie erwerben und besitzen. Waren Kunstsammler oft scheu und diskret, da sie sich von der intimen Begegnung mit den Werken exklusive Erfahrungen versprachen, demonstrieren Fans im Gegenteil gerne ihre Nähe zu den Stars und Marken, suchen aber genauso Verbindung mit anderen Fans. Sie machen ihre Vorlieben also öffentlich, und seit einigen Jahren ist das dank der Sozialen Medien auch unkompliziert und wirkungsvoll möglich. Umgekehrt begünstigen die Strukturen der Sozialen Medien die Entwicklung, Kunstwerke mit Luxusprodukten gleichzustellen und als Teil eines gehobenen, markenseligen Lifestyles in Szene zu setzen.
Auf Instagram sind mittlerweile zahlreiche Accounts von Leuten zu finden, die Millionen auf dem Kunst- und Luxusgütermarkt ausgegeben haben. Etliche der Werke, deren spektakuläre Versteigerung es in die Berichterstattung der herkömmlichen Medien – Fernsehen, Zeitung – geschafft hat, entdeckt man auf einmal auf Fotos von Salons und Wohnzimmern wieder: zwischen anderen Werken, inmitten von Möbeln, Teppichen und, je nach Jahreszeit und Familienverhältnissen, auch mal neben einem Christbaum oder in der Nachbarschaft von Kinderspielzeug. Man bekommt Einblicke, von denen man früher kaum träumen durfte, und sieht, wie Fans sich so gut und aufwendig inszenieren, dass sie selbst zu Stars werden.
Einer dieser Fans, der mittlerweile wohl berühmter dafür ist, wie er sein Geld ausgibt, als wie er es verdient, ist der japanische Milliardär Yusaku Maezawa. Dabei ist auch seine geschäftliche Karriere schon außergewöhnlich genug, gelang es ihm doch, mit seinem Unternehmen Zozotown zum wichtigsten japanischen Internet-Modehändler zu werden. (Zozotown ist das japanische Pendant zu Zalando.) Der Kunstwelt fiel Maezawa erstmals 2016 auf, als er bei einer Auktion von Christie’s in New York insgesamt mehr als 80 Millionen Dollar ausgab – für Werke von Richard Prince, Jeff Koons, Alexander Calder und Bruce Nauman, vor allem aber für ein Gemälde von Jean-Michel Basquiat, das allein schon mehr als 57 Millionen kostete, was damals einen Weltrekord für diesen Künstler bedeutete. Seither erschienen einige Interviews und Homestories, die meist mit Aufzählungen dessen beginnen, was bei Maezawa noch alles hängt und steht: Picasso, Giacometti, de Kooning, aber genauso Möbel von Jean Prouvé oder Jean Royère. Dabei war Maezawa keineswegs immer schon an Kunst interessiert, vielmehr habe er „die ersten Kunstwerke nur gekauft […], um die leeren Wände in meinem Haus zu füllen“. Bis dahin habe er „kaum jemals einen Fuß in ein Museum gesetzt“.[15]
Spätestens mit seinem Basquiat jedoch wurde Maezawa zum Fan. Auf seinem Instagram-Account (@yuzaku2020) feierte er die Ankunft des Gemäldes in Japan mit einer Reihe von Detailfotos, dann stellte er es in seinem Unternehmen aus, wo seine Angestellten es fotografierten und posteten. Nur ein Jahr später schlug er erneut zu – und ersteigerte bei Sotheby’s einen zweiten Basquiat, diesmal zum fast doppelten Preis, 110 Millionen Dollar, erneut Weltrekord. Kaum bekommt er den Zuschlag, verkündet er es via Twitter und Instagram.
Da er nicht selbst vor Ort in New York ist, sondern per Telefon mitbietet, illustriert er die Nachricht mit Fotos, die ihn einige Tage vor der Versteigerung vor dem Basquiat zeigen, mit einem T-Shirt, das Comme des Garçons in Kooperation mit Fornasetti produziert hat. Schon am Tag darauf postet er Fotos, die die Rückseite des Gemäldes zeigen, auf denen er Fußspuren des Künstlers entdeckt hat. Sie machen ihn, wie es sich für einen echten Fan gehört, glücklicher als jeder Pinselstrich. Es folgt ein Video darüber, wie er sein Bild das erste Mal besucht, und natürlich wird auch die Ankunft des Basquiat in Japan groß zelebriert. Dafür verwendet Maezawa den Hashtag #goodshopping, der auf Instagram sonst vor allem genutzt wird, wenn jemand sich über einen Glücksfund oder ein Markenschnäppchen freut.
In den Monaten darauf genießt es Maezawa, seinen Basquiat möglichst vielen Menschen zu zeigen. Besonders freut es ihn, wenn Kindern das Bild gefällt. Er schickt es auf Tournee in Museen rund um die Welt, was Basquiat und ihn selbst noch berühmter macht. Er landet auf den Titeln diverser Kunstmagazine und trifft auch immer wieder andere Prominente, die ihrerseits daran arbeiten, als Marken noch markanter und interessanter zu werden – und für die es daher reizvoll ist, sich mit einem Kunstsammler ablichten und etwas vom rebellischen Underground-Image Basquiats auf sich abfärben zu lassen.
Dass dessen Motive seit 2017 allenthalben boomen und auf Skateboards, Skier und Geschirr gedruckt werden, muss nicht in jedem Fall an Maezawas Einsatz liegen, doch ist er daran sicher nicht unschuldig. Stolz trägt er auch selbst Shirts und Hemden mit Basquiat-Applikationen, wiederum von Comme des Gartons. Der Fan wäre aber noch nicht perfekt, würde er nicht auch eine zum Geburtstag geschenkte Torte verspeisen, auf die sein Gemälde gedruckt ist.
So wenig also auch Maezawa zwischen ‚high’ und ‚low’ trennt, so wenig stellt Kunst für ihn ein Sonderfall dar. Vielmehr steht sie als Bereich mit vielen aufregenden Marken auf einer Stufe mit anderen Bereichen mit ähnlich starken Labels. Der Basquiat mag das teuerste Einzelstück sein, das Maezawa bisher erworben hat, aber stolz zeigt er immer wieder genauso die Weine, Uhren, Möbel oder Autos („it’s almost art“), die ihm gehören.

Und natürlich hat er sich 2017 auch den Ferraribei Sotheby’s angeschaut.
Mittlerweile aber plant Maezawa noch Größeres. 2023 will er mit einem von Elon Musk produzierten Raumschiff zum Mond fliegen – das aber nicht alleine, sondern zusammen mit Künstlern.
Sein Engagement – mindestens 200 Millionen – soll es einigen der größten Maler, Filmemacher, Modedesigner und Schriftsteller, einigen seiner Idole, ermöglichen, ganz neue Erfahrungen zu machen – und Werke zu schaffen, die sie sonst nie schaffen könnten. Spätestens dann würde Maezawa weltberühmt werden, als größter denkbarer Fan.
Und Loïc Gouzer? Er hat seinen Job bei Christie’s Ende 2018 aufgegeben. Denn er hat etwas entdeckt, das ihm noch wichtiger ist als die Kunst. Das ist die Natur, sind vor allem die Meere, sind vom Aussterben bedrohte Tierarten. Für sie will er sich einsetzen und als Naturschützer ähnlich erfolgreich werden wie als Auktionskurator. Schon im Mai 2018 hatte er nach einer für ihn wieder einmal sehr erfolgreichen Auktionswoche – ebenfalls auf Instagram – ein bemerkenswertes Statement publiziert:
„Bald wird es auf diesem Planeten weniger Nashörner als Gemälde von Mark Rothko geben. Ist es nicht an der Zeit, sich klar zu machen, dass Nashörner und andere Arten professionellen Schutz und dasselbe Ausmaß an finanziellem Einsatz benötigen wie die Künste?“ („Soon there will be less Rhinos than there are Mark Rothkos paintings on this planet, isn’t it time that we realize that rhinos and other species deserve state of the art protection and the same amount of spending power we see in the arts?”)[16] Und in dem schon öfter zitierten Interview vom Juni 2018 formuliert er es noch deutlicher. So glücklich er gewesen sei, als der Leonardo für 450 Millionen Dollar verkauft worden sei, so sehr habe ihn zugleich der Gedanke beschäftigt, was es bedeute, würde dieselbe Summe zur Rettung eines sterbenden Ökosystems etwa in Indonesien genutzt. Sein Wunsch sei es, dass künftig zumindest ein Zehntel des Geldes, das Leute für Kunst ausgeben, für die Bewahrung der „Meisterwerke der Natur“ („the masterpieces of nature“) verwendet werde.[17]
Nun also setzt Gouzer Kunstwerke und Arten der Natur ausdrücklich gleich, sieht in beidem etwas besonders Wertvolles, das deshalb auch besonderen Schutzes bedarf. Doch dient der Vergleich nicht mehr dazu, die Kunstgeschichte in Analogie zur Naturgeschichte zu denken, sondern zeugt im Gegenteil davon, wie sehr Gouzer bereits vom westlich-modernen Begriff von Kunst – und damit auch von einer Idee von Kunstgeschichte – Abschied genommen hat. Statt Kunst als autonomes Feld zu betrachten, das sich von allem anderen grundsätzlich unterscheidet, wird sie jetzt zwar nicht mit Luxusprodukten und Marken, dafür aber mit Tieren und Pflanzen gleichgestellt. Das war seit der Zeit der Kunst- und Wunderkammern, seit dem Glauben an eine alles umfassende Schöpfung nicht mehr möglich. Und es weist einen Weg in eine mögliche Zukunft. In ihr werden Superreiche – dank des kuratorischen Geschicks von Leuten wie Gouzer – kapieren, dass es noch cooler ist und noch mehr Status bringt, eine Tierart vor dem Aussterben zu retten, als einen Rothko oder einen Basquiat zu erwerben. Und so wird sich vermutlich schon in den nächsten Jahren zeigen: Wenn Kunst erst einmal mit anderem gleichgestellt ist, führen zwar mehr Wege zu ihr hin, aber auch mehr von ihr weg.
Anmerkungen
[1] Hier und im Folgenden: “’The Whole Way of Collecting Has Changed’: Christie’s Loïc Gouzer on the Regrettable Rise of the ADD Art Collector” (2018), auf: https://news.artnet.com/art-world/the-whole-way-of-ollecting-has-changed-1298714.
[2] Vgl. Henri Neuendorf: „Loic Gouzer and the Rise of Curated Auctions“ (2016), auf: https://news.artnet.com/market/curated-art-auctions-trend-493952.
[3] Jean-Hubert Martin (Hg.): Künstlermuseum, Düsseldorf 2002, S. 9f.
[4] Bogomir Ecker: „Statement gehalten anläßlich des Herbsttreffens des Museumsbundes“ (2001), zit. n. ebd., S. 202f.
[5] https://www.me-berlin.com/olbricht-collection/.
[6] https://www.me-berlin.com/wp-content/uploads/2017/11/Final_WK_DE_Werkliste_A4_INHOUSE_171106_HH.pdf-
[7]https://www.portalkunstgeschichte.de/kalender/termin/_all_art_has_been_contemporary_-7737.html.
[8] Ders.: „Hier wird ein Machtkampf inszeniert“, in: Die Welt vom 18. August 2001, zit. n. Jean-Hubert Martin, a.a.O. (Anm. 3), S. 192.
[9] Brief der Fachgruppe kulturhistorische Museen und Kunstmuseen im Deutschen Museumsbund an den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Joachim Werner, vom 2. Juli 2001, zit. n. ebd., S. 186.
[10] Gabriele Beßler: „Eine unheilige Trias in Stuttgart. ‚Turner, Monet, Twombly’ in der Staatsgalerie “ (2012), auf: https://blog.arthistoricum.net/en/beitrag/2012/02/29/eine-unheilige-trias-in-stuttgart-turner-monet-twombly-in-der-staatsgalerie/
[11] Zit. n. Rebecca Mead: „The Daredevil of the Auction World”, New Yorker vom 4. Juli 2016, auf: https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/loic-gouzer-the-daredevil-at-christies.
[12] Wie Anm. 1.
[13] Vgl. Kia Vahland: „Die Fiktion bröckelt“, auf: https://www.sueddeutsche.de/kultur/malerei-die-fiktion-broeckelt-1.4202442.
[14] Wie Anm. 1.
[15] Marcus Woeller: „Darum zahlte ich 110 Millionen Dollar für ein Bild“ (2017), auf: https://www.welt.de/kultur/kunst/article165391528/Darum-zahlte-ich-110-Millionen-Dollar-fuer-ein-Bild.html.
[16] https://www.instagram.com/p/BjDp_fVHF1h/.
[17] Wie Anm. 1.
Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, den Wolfgang Ullrich im Januar diesen Jahres im Rahmen der Deutsche Bank Stiftungsgastprofessur „Wissenschaft und Gesellschaft“ an der Goethe-Universität Frankfurt hielt.